In lieblicher Bläue
In lieblicher Bläue blühet
mit dem metallenen Dache der Kirchthurm. Den umschwebet
Geschrei der Schwalben, den umgiebt die rührendste Bläue.
Die Sonne gehet hoch darüber und färbet das Blech,
im Winde aber oben stille krähet die Fahne.
Wenn einer unter der Glocke dann herabgeht, jene Treppen,
ein stilles Leben ist es, weil,
wenn abgesondert so sehr die Gestalt ist,
die Bildsamkeit herauskommt dann des Menschen.
Die Fenster, daraus die Glocken tönen, sind wie Thore an Schönheit.
Nemlich, weil noch der Natur nach sind die Thore,
haben diese die Ähnlichkeit von Bäumen des Walds.
Reinheit aber ist auch Schönheit.
Innen aus Verschiedenem entsteht ein ernster Geist.
So sehr einfältig aber die Bilder, so sehr heilig sind die, daß
man wirklich oft fürchtet, die zu beschreiben.
Die Himmlischen aber, die immer gut sind,
alles zumal, wie Reiche, haben diese, Tugend und Freude.
Der Mensch darf das nachahmen.
Darf, wenn lauter Mühe das Leben, ein Mensch
aufschauen und sagen: so will ich auch seyn?
Ja. So lange die Freundlichkeit noch am Herzen, die Reine,
dauert, misset nicht unglücklich der Mensch sich
der Gottheit.
Ist unbekannt Gott? Ist er offenbar wie die Himmel?
dieses glaub’ ich eher. Des Menschen Maaß ist’s.
Voll Verdienst, doch dichterisch,
wohnet der Mensch auf dieser Erde. Doch reiner
ist nicht der Schatten der Nacht mit den Sternen,
wenn ich so sagen könnte,
als der Mensch, der heißet ein Bild der Gottheit.
Giebt auf Erden ein Maaß?
Es giebt keines. Nemlich
es hemmen der Donnergang nie die Welten des Schöpfers.
Auch eine Blume ist schön, weil sie blühet unter der Sonne.
Es findet das Aug’ oft im Leben
Wesen, die viel schöner noch zu nennen wären
als die Blumen. O! ich weiß das wohl!
Denn zu bluten an Gestalt und Herz,
und ganz nicht mehr zu seyn, gefällt das Gott ?
Die Seele aber, wie ich glaube, muß rein bleiben,
sonst reicht an das Mächtige auf Fittigen der Adler mit lobendem Gesange
und der Stimme so vieler Vögel.
Es ist die Wesenheit, die Gestalt ist’s.
Du schönes Bächlein, du scheinest rührend, indem du rollest so klar,
wie das Auge der Gottheit, durch die Milchstraße.
Ich kenne dich wohl,
aber Thränen quillen aus dem Auge. Ein heiteres Leben
seh’ ich in den Gestalten mich umblühen der Schöpfung, weil
ich es nicht unbillig vergleiche den einsamen Tauben auf dem Kirchhof.
Das Lachen aber scheint mich zu grämen der Menschen,
nemlich ich hab’ ein Herz.
Möcht’ ich ein Komet seyn?
Ich glaube. Denn sie haben Schnelligkeit der Vögel; sie blühen an Feuer,
und sind wie Kinder an Reinheit.
Größeres zu wünschen, kann nicht des Menschen Natur sich vermessen.
Der Tugend Heiterkeit verdient auch gelobt zu werden vom ernsten Geiste,
der zwischen den drei Säulen wehet
des Gartens. Eine schöne Jungfrau muß das Haupt umkränzen
mit Myrthenblumen, weil sie einfach ist
ihrem Wesen nach und ihrem Gefühl. Myrthen aber
giebt es in Griechenland.
Wenn einer in den Spiegel siehet,
ein Mann, und siehet darinn sein Bild, wie abgemahlt;
es gleicht dem Manne.
Augen hat des Menschen Bild,
hingegen Licht der Mond.
Der König Ödipus hat ein Auge zuviel vielleicht.
Diese Leiden dieses Mannes, sie scheinen unbeschreiblich, unaussprechlich,
unausdrüklich.
Wenn das Schauspiel ein solches darstellt, kommt’s daher.
Wie ist mir’s aber, gedenk’ ich deiner jetzt?
Wie Bäche reißt des Ende von Etwas mich dahin,
welches sich wie Asien ausdehnet.
Natürlich dieses Leiden, das hat Ödipus.
Natürlich ist’s darum.
Hat auch Herkules gelitten?
Wohl. Die Dioskuren in ihrer Freundschaft
haben die nicht Leiden auch getragen? Nemlich
wie Herkules mit Gott zu streiten, das ist Leiden.
Und die Unsterblichkeit im Neide dieses Leben,
diese zu theilen, ist ein Leiden auch.
Doch das ist auch ein Leiden, wenn mit Sommerflecken ist bedeckt ein Mensch,
mit manchen Flecken ganz überdeckt zu seyn! Das thut die schöne Sonne:
nemlich die ziehet alles auf.
Die Jünglinge führt die Bahn sie mit Reizen ihrer Strahlen
wie mit Rosen.
Die Leiden scheinen so,
die Ödipus getragen,
als wie ein armer Mann klagt,
daß ihm etwas fehle.
Sohn Laios, armer Fremdling in Griechenland!
Leben ist Tod, und Tod ist auch ein Leben.
Friedrich Hölderlin (1808)
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/19Jh/Hoelderlin/hoe_0801.html

Was ist Gott?
Was ist Gott? unbekannt, dennoch
Voll Eigenschaften ist das Angesicht
Des Himmels von ihm. Die Blize nemlich
Der Zorn sind eines Gottes. Jemehr ist eins
Unsichtbar, schiket es sich in Fremdes. Aber der Donner
Der Ruhm ist Gottes. Die Liebe zur Unsterblichkeit
Das Eigentum auch, wie das unsere,
Ist eines Gottes.

Was ist der Menschen Leben?
Was ist der Menschen Leben? ein Bild der Gottheit.
Wie unter dem Himmel wandeln die Irdischen alle, sehen
Sie diesen. Lesend aber gleichsam, wie
In einer Schrift, die Unendlichkeit nachahmen und den Reichtum
Menschen. Ist der einfältige Himmel
Denn reich? Wie Blüthen sind ja
Silberne Wolken. Es regnet aber von daher
Der Thau und das Feuchte. Wenn aber
Das Blau ist ausgelöschet, das Einfältige, scheint
Das Matte, das dem Marmelstein gleichet, wie Erz,
Anzeige des Reichtums.

Der Adler
Mein Vater ist gewandert, auf dem Gotthard,
Da wo die Flüsse, hinab,
Wohl nach Hetruria seitwärts,
Und des geraden Weges
Auch über den Schnee,
Zu dem Olympos und Hämos
Wo den Schatten der Athos wirft,
Nach Höhlen in Lemnos.
Anfänglich aber sind
Aus Wäldern des Indus
Starkduftenden
Die Eltern gekommen.
Der Urahn aber
Ist geflogen über der See
Scharfsinnend, und es wunderte sich
Des Königes goldnes Haupt
Ob dem Geheimnis der Wasser,
Als roth die Wolken dampften,
Über dem Schiff und die Thiere stumm
Einander schauend
Der Speise gedachten, aber
Es stehen die Berge doch still,
Wo wollen wir bleiben?
Reh.
Der Fels ist zu Waide gut,
Das Trokne zu Trank.
Das Nasse aber zu Speise.
Will einer wohnen,
So sei es an Treppen,
Und wo ein Häuslein hinabhängt
Am Wasser halte dich auf.
Und was du hast, ist
Athem zu hohlen.
Hat einer ihn nemlich hinauf
Am Tage gebracht,
Er findet im Schlaf ihn wieder.
Denn wo die Augen zugedekt,
Und gebunden die Füße sind,
Da wirst du es finden.
Denn wo erkennest,
Die Wanderung
Glückselig Suevien, meine Mutter!
Auch du, der glänzenderen, der Schwester
Lombarda drüben gleich,
Von hundert Bächen durchfloßen!
Und Bäume genug, weisblühend und rötlich,
Und dunklere, wild, tiefgrünenden Laubs voll,
Und Alpengebirg der Schweiz auch überschattet
Benachbartes, dich; denn nah dem Heerde des Hauses
Wohnst du, und hörst, wie drinnen
Aus silbernen Opferschalen
Der Quell rauscht, ausgeschüttet
Von reinen Händen, wenn berührt
Von warmen Stralen
Kristallenes Eis, und umgestürzt
Vom leichtanregenden Lichte
Der schneeige Gipfel übergießt die Erde
Mit reinestem Wasser. Darum ist
Dir angeboren die Treue. Schwer verläßt
Was nahe dem Ursprung wohnet, den Ort.
Und deine Kinder, die Städte,
Am weithin dämmernden See,
An Neckars Weiden, am Rheine,
Sie alle meinen, es wäre
Sonst nirgend besser zu wohnen.
Ich aber will dem Kaukasos zu!
Denn sagen hört’ ich
Noch heut in den Lüften:
Frei sei’n, wie Schwalben, die Dichter.
Auch hat mir ohnedies
In jüngeren Tagen einer vertraut,
Es seien, vor alter Zeit,
Die Eltern einst, das scharfe Geschlecht,
Still fortgezogen, von Wellen der Donau,
Am strengstem Tage, staunendes Geistes, da diese
Sich Schatten suchten, zusammen
Am schwarzen Meere gekommen;
Und nicht umsonst sei dies
Das gastfreundliche genennet.
Denn, als sie erst sich angesehen,
Da nahten die Andern zuerst. Dann sazten auch
Die Unseren sich neugierig unter
Den Ölbaum. Doch als nun sich ihre Gewande
Berührt, und keiner vernehmen konnte
Die eigene Rede des andern, wäre fast
Entstanden ein Zwist, wenn nicht aus Zweigen herunter
Gekommen wäre die Kühlung,
Die Lächeln über das Angesicht
Der Streitenden öfters breitet. Und eine Weile
Sahn still sie auf. Dann reichten sie sich
Die Hände liebend einander. Und bald
Vertauschten sie Waffen und all
Die lieben Güter des Hauses;
Vertauschten das Wort auch. Und es wünschten
Die freundlichen Väter umsonst nichts
Beim Hochzeitjubel den Kindern.
Denn aus den Heiligvermählten
Wuchs schöner denn Alles,
Was vor und nach
Von Menschen sich nannt’, ein Geschlecht auf. Wo,
Wo aber wohnt ihr, liebe Verwandten,
Daß wir das Bündnis wiederbegehn,
Und der theuren Ahnen gedenken?
Dort an den Ufern, unter den Bäumen
Ionias, in Ebenen des Kaüstros,
Wo Kraniche, des Äthers froh,
Umschlossen sind von fernhindämmernden Bergen,
Dort wart auch ihr, ihr Schönsten! oder pflegtet
Der Inseln, die mit Wein bekränzt,
Voll tönten von Gesang; noch andere wohnten
Am Taüget, am vielgepriesnen Hümettos,
Die blühten zulezt. Doch von
Parnassos Quell bis zu des Tmolos
Goldglänzenden Bächen erklang
Ein ewig Lied. So rauschten damals
Die heiligen Wälder und all
Die Saitenspiele zusamt,
Von himmlischer Milde gerühret.
O Land des Homer!
Am purpurnen Kirschbaum oder wenn,
Von dir gesandt, im Weinberg mir
Die jungen Pfirsiche grünen,
Und die Schwalbe fernher kommt und vieles erzählend
An meinen Wänden ihr Haus baut, in
Den Tagen des Mais, auch unter den Sternen
Gedenk ich, o Ionia! dein. Doch Menschen
Ist Gegenwärtiges lieb. Drum bin ich
Gekommen, euch, ihr Inseln, zu sehn und euch,
Ihr Mündungen der Ströme, o ihr Hallen der Thetis,
Ihr Wälder, euch, und euch, ihr Wolken des Ida!
Doch nicht zu bleiben gedenk ich,
Unbiegsam ist und schwer zu gewinnen
Die Verschlossene, der ich entkommen, die Mutter.
Von ihren Söhnen einer, der Rhein,
Mit Gewalt wollt’ er ans Herz ihr stürzen und schwand,
Der Zurückgestoßene, niemand weiß, wohin in die Ferne.
Doch so nicht wünscht’ ich gegangen zu sein,
Von ihr, und nur, euch einzuladen
Bin ich zu euch, ihr Grazien Griechenlands,
Ihr Himmelstöchter, gegangen,
Daß, wenn die Reise zu weit nicht ist,
Zu uns ihr kommet, ihr Holden!.
Hölderlin

Andenken
Der Nordost wehet,
Der liebste unter den Winden
Mir, weil er feurigen Geist
Und gute Fahrt verheißet den Schiffern.
Geh aber nun und grüße
Die schöne Garonne,
Und die Gärten von Bourdeaux
Dort, wo am scharfen Ufer
Hingehet der Steg und in den Strom
Tief fällt der Bach, darüber aber
Hinschauet ein edel Paar
Von Eichen und Silberpappeln;
Noch denket das mir wohl und wie
Die breiten Gipfel neiget
Der Ulmwald, über die Mühl’,
Im Hofe aber wächset ein Feigenbaum.
An Feiertagen gehn
Die braunen Frauen daselbst
Auf seidnen Boden,
Zur Märzenzeit,
Wenn gleich ist Nacht und Tag,
Und über langsamen Stegen,
Von goldenen Träumen schwer,
Einwiegende Lüfte ziehen.
Es reiche aber,
Des dunkeln Lichtes voll,
Mir einer den duftenden Becher,
Damit ich ruhen möge; denn süß
Wär’ unter Schatten der Schlummer.
Nicht ist es gut,
Seellos von sterblichen
Gedanken zu seyn. Doch gut
Ist ein Gespräch und zu sagen
Des Herzens Meinung, zu hören viel
Von Tagen der Lieb’,
Und Thaten, welche geschehen.
Wo aber sind die Freunde? Bellarmin
Mit dem Gefährten? Mancher
Trägt Scheue, an die Quelle zu gehn;
Es beginnet nemlich der Reichtum
Im Meere. Sie,
Wie Mahler, bringen zusammen
Das Schöne der Erd’ und verschmähn
Den geflügelten Krieg nicht, und
Zu wohnen einsam, jahrlang, unter
Dem entlaubten Mast, wo nicht die Nacht durchglänzen
Die Feiertage der Stadt,
Und Saitenspiel und eingeborener Tanz nicht.
Nun aber sind zu Indiern
Die Männer gegangen,
Dort an der luftigen Spiz’
An Traubenbergen, wo herab
Die Dordogne kommt,
Und zusammen mit der prächt’gen
Garonne meerbreit
Ausgehet der Strom. Es nehmet aber
Und giebt Gedächtniß die See,
Und die Lieb’ auch heftet fleißig die Augen,
Was bleibet aber, stiften die Dichter.

Die Nacht.
Rings um ruhet die Stadt. Still wird die erleuchtete Gasse,
Und mit Fackeln geschmückt rauschen die Wagen hinweg.
Satt gehn heim von Freuden des Tags zu ruhen, die Menschen,
Und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt
Wolzufrieden zu Haus; leer steht von Trauben und Blumen,
Und von Werken der Hand ruht der geschäftige Markt.
Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten; vielleicht, daß
Dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann
Ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit; und die Brunnen
Immerquillend und frisch rauschen an duftendem Beet.
Still in dämmriger Luft ertönen geläutete Glocken,
Und der Stunden gedenk rufet ein Wächter die Zahl.
Jezt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des Hains auf,
Sieh! und das Ebenbild unserer Erde, der Mond,
Kommet geheim nun auch, die schwärmerische, die Nacht kommt,
Voll mit Sternen, und wol wenig bekümmert um uns
Glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen
Über Gebirganhöhn traurig und prächtig herauf.
Hölderlin
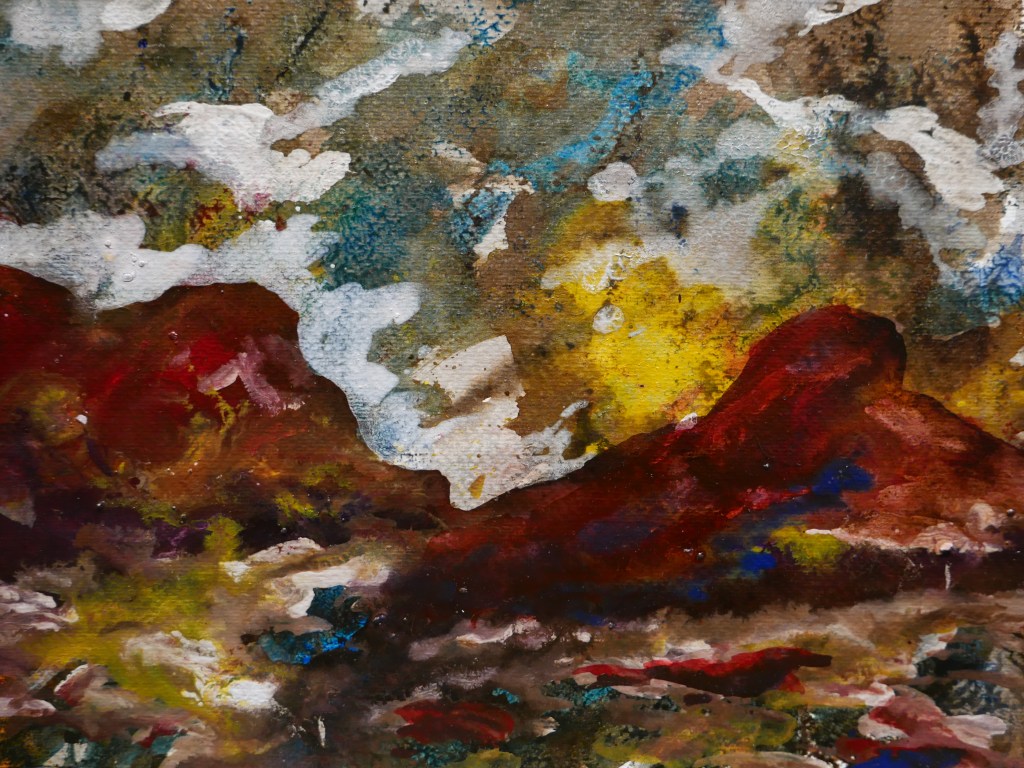
Die Herbstfeier.
An Siegfried Schmidt.
1
Wieder ein Glück erlebt. Die gefährliche Dürre geneset,
Und die Schärfe des Lichts senget die Blüte nicht mehr.
Offen steht jezt wieder ein Saal, und gesund ist der Garten,
Und von [R]egen erfrischt rauschet das glänzende Thal,
Hoch von Gewächsen. Es schwellen die Bäch’, und alle gebundnen
Fittige wagen sich wieder ins Reich des Gesangs.
Voll ist die Luft von Fröhlichen jezt und die Stadt und der Hain ist
Rings von zufriedener Schaar Kinder des Himmels erfüllt.
Gerne begegnen sie sich, und irren untereinander,
Sorgenlos, und es scheint keines zu wenig, zu viel.
Denn so ordnet das Herz es an in lieblicher Anmut,
Sie, die geschickliche, schenkt ihnen ein göttlicher Geist.
Aber die Wanderer auch sind wolgeleitet und haben
Kränze genug und Gesang, haben den heiligen Stab
Vollgeschmückt mit Trauben und Laub, bei sich, und der Fichte
Schatten; von Dorfe zu Dorf jauchzt es, von Tage zu Tag,
Und wie Wagen, bespannt mit Hirschen und Rehen, so ziehn die
Berge voran, und so träget und eilet der Pfad.
2
Aber meinest du nun, es haben die Thore vergebens
Aufgethan und den Weg freudig die Götter gemacht;
Und es schenken umsonst zu des Gastmals Fülle die Guten
Nebst dem Wein’ uns noch Beeren und Honig und Obst?
Schenken das purpurne Licht zu Festgesängen und kühl und
Ruhig zu tieferem Freundesgespräche die Nacht?
Hält ein Ernsteres dich, so spar es dem Winter und willst du
Freien, habe Geduld, Freier beglücket der Mai.
Jezt ist anderes Not, jezt komm’ und feire des Herbstes
Alte Sitte, noch jezt blühet die Edle mit uns.
Eins nur gilt für den Tag, das Vaterland, und des Opfers
Festlicher Flamme wirft jeder das Eigene zu.
Darum kränzt der gemeinsame Gott umsäuselnd das Haar uns
Und den eigenen Sinn schmelzet, wie Perlen, der Wein.
Dies bedeutet der Tisch, der geehrte, wenn, wie die Bienen,
Rund um den Eichbaum, wir sizen und singen um ihn,
Dies der Pokale Klang und darum zwinget die wilden
Seelen der streitenden Männer zusammen der Chor.
3
Aber damit uns nicht, gleich Allzuklugen, entfliehe
Diese neigende Zeit, komm’ ich entgegen sogleich
Bis an die Gränze des Lands, wo mir den lieben Geburtsort
Und die Insel des Stroms blaues Gewässer umfließt.
Seeligen lieb ist der Ort an beiden Ufern, der Fels auch,
Der mit Garten und Haus grün aus den Wellen sich hebt.
Dort begegnen wir uns, o gütiges Licht, wo zuerst einst
Deiner gestaltenden Stralen mich einer betraf.
Dort begann und beginnt das liebe Leben. Was ist es
Aber? des Vaters Grab seh ich, und weine dir schon?
Wein’ und halt’ und habe den Freund und höre das Wort, das
Einst mir, in himmlischer Kunst, Leiden der Liebe geheilt.
Andres erwacht. Ich muß des Landes Blüten ihm nennen,
Barbarossa! Dich auch, treuester Christof, und dich,
Konradin! So arm ist des Volks Mund. Aber der Efeu
Grünt am Fels und die Burg deckt das bacchantische Laub,
Doch Vergangenes ist und Entschiedenes fürstlich den Sängern,
Und in Tagen des Herbsts sühnen die Schatten wir aus.
4
So der Gewaltgen gedenk, und des ernst ankündenden Schicksals,
Welches sie Vorbild hieß schwächerem Enkelgeschlecht!
Aber geschaut, und dahin! wie die Alten, die göttlich erzognen
Dichter, heimischen Lichts, ziehn das Land wir hinauf.
Wirtemberg ist’s. Dort von den uralt deutsamen Bergen
Stammen der Jünglinge viel, steigen die Hügel herab.
Quellen rauschen von dort und hundert geschäftige Bäche
Kommen bei Tag und bei Nacht nieder und biegen das Land.
Aber der Meister pflügt die Mitte des Landes, die Furchen
Ziehet der Neckarstrom, ziehet den Segen hinab.
Und es kommen mit ihm Italiens Lüfte, die See schickt
Frischungen, aber zugleich brennende Sonnen mit ihm.
Darum wächset uns auch fast über das Haupt die Gewalt mit
Güterfülle, denn hier ward in die Ebne das Gut
Reicher den Lieben gebracht, den Landesleuten, doch neidet
Keiner im Oberland denen die Gärten, den Wein
Oder das üppige Gras und das Korn und die glühenden Bäume,
Die am Wege gereiht über den Wanderern stehn.
5
Aber indeß wir schaun und die mächtige Freude durchwandeln,
Fliehet der Weg und der Tag uns, wie den Trunkenen hin.
Denn mit heiligem Laub umkränzt erhebet die Stadt schon
Sie, die gepriesene, dort leuchtend ihr priesterlich Haupt.
Herrlich steht sie und hält den Rebenstab und die Tanne
Hoch in den seeligen Duft purpurner Wolken empor.
Sei uns hold! dem Gast und dem Sohn, o Fürstin der Heimat,
Glückliches Stutgard! Nimm freundlich den Sänger mir auf!
Immer hast du Gesang mit Flöten und Saiten gebilligt,
Fröhliche du! und des Lieds kindlich Geschwäze, der Mühn
Süße Vergessenheit bei gegenwärtigem Geiste –
Gerne gedekst du der Zeit, wo es noch wurde vergönnt.
Aber ihr, ihr Tapfersten auch, ihr Frohen, die allzeit
Leben und walten, erkannt, oder gewaltiger auch,
Wenn ihr wirket und schafft in heiliger Nacht und allein herrscht,
Und allmächtig empor ziehet ein ahnendes Volk,
Bis die Jünglinge sich der Väter droben erinnern,
Kündig und hell vor euch steht ein gemütliches Volk,
6
Engel des Vaterlands! o ihr, vor denen das Auge,
Sei’s auch stark, und das Knie bricht dem vereinzelten Mann,
Daß er halten sich muß an die Freund’ und bitten die Theuern,
Daß sie tragen mit ihm all die beglückende Last,
Habt, o Gütige, Dank für sie, und alle die Andern,
Die mein Leben, mein Gut unter den Sterblichen sind.
Aber die Nacht kommt. Laß uns eilen, zu feiern das Herbstfest
Heut noch. Voll ist das Herz, aber das Leben ist kurz.
Und was uns der himmlische Tag zu sagen geboten,
Das zu nennen, mein Schmidt, reichen wir Beide nicht aus.
Trefliche bring ich dir und das Freudenfeuer wird hoch auf
Schlagen und heiliger soll sprechen das kühnere Wort.
Siehe! da ist es rein. Und des Gottes freundliche Gaben,
Die wir theilen, sie sind zwischen den Liebenden nur.
Anderes nicht. O kommt, o macht es wahr, denn allein ja
Bin ich und niemand nimmt mir von der Stirne den Traum!
Kommt und reicht, ihr Lieben, die Hand. Das möge genug sein,
Aber die grössere Lust sparen dem Enkel wir auf.
Hölderlin

Hälfte des Lebens.
―――――――
Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm’ ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.
Die Götter
Du stiller Aether! immer bewahrst du schön
Die Seele mir im Schmerz, und es adelt sich
Zur Tapferkeit vor deinen Stralen,
Helios! oft die empörte Brust mir.
Ihr guten Götter! arm ist, wer euch nicht kennt,
Im rohen Busen ruhet der Zwist ihm nie,
Und Nacht ist ihm die Welt und keine
Freude gedeihet und kein Gesang ihm.
Nur ihr, mit eurer ewigen Jugend, nährt
In Herzen die euch lieben, den Kindersinn,
Und laßt in Sorgen und in Irren
Nimmer den Genius sich vertrauern.

Die Aussicht
Wenn in die Ferne geht der Menschen wohnend Leben,
Wo in die Ferne sich erglänzt die Zeit der Reben,
Ist auch dabei des Sommers leer Gefilde,
Der Wald erscheint mit seinem dunklen Bilde.
Dass die Natur ergänzt das Bild der Zeiten,
Dass die verweilt, sie schnell vorübergleiten,
Ist aus Vollkommenheit, des Himmels Höhe glänzet
Den Menschen dann, wie Bäume Blüt′ umkränzet.
Friedrich Hölderlin
****
Aussicht [1]
Wenn Menschen fröhlich sind, ist dieses vom Gemüte,
Und aus dem Wohlergehn, doch aus dem Felde kommet,
Zu schaun der Bäume Wuchs, die angenehme Blüte,
Da Frucht der Ernte noch den Menschen wächst und frommet.
Gebirg umgibt das Feld, vom Himmel hoch entstehet
Die Dämmerung und Luft, der Ebnen sanfte Wege
Sind in den Feldern fern, und über Wasser gehet
Der Mensch zu Örtern dort die kühn erhöhten Stege.
Erinnerung ist auch dem Menschen in den Worten,
Und der Zusammenhang der Menschen gilt die Tage
Des Lebens durch zum Guten in den Orten,
Doch zu sich selber macht der Mensch des Wissens Frage.
Die Aussicht scheint Ermunterung, der Mensch erfreuet
Am Nutzen sich, mit Tagen dann erneuet
Sich sein Geschäft, und um das Gute waltet
Die Vorsicht gut, zu Dank, der nicht veraltet.
Aussicht [2]
Der offne Tag ist Menschen hell mit Bildern,
Wenn sich das Grün aus ebner Ferne zeiget,
Noch eh des Abends Licht zur Dämmerung sich neiget,
Und Schimmer sanft den Klang des Tages mildern.
Oft scheint die Innerheit der Welt umwölkt, verschlossen,
Des Menschen Sinn von Zweifeln voll, verdrossen,
Die prächtige Natur erheitert seine Tage
Und ferne steht des Zweifels dunkle Frage.

Höheres Leben
Der Mensch erwählt sein Leben, sein Beschließen,
Von Irrtum frei kennt Weisheit er, Gedanken,
Erinnrungen, die in der Welt versanken,
Und nichts kann ihm der innern Wert verdrießen.
Die prächtige Natur verschönet seine Tage,
Der Geist in ihm gewährt ihm neues Trachten
In seinem Innern oft, und das, die Wahrheit achten,
Und höhern Sinn, und manche seltne Frage.
Dann kann der Mensch des Lebens Sinn auch kennen,
Das Höchste seinem Zweck, das Herrlichste benennen,
Gemäß der Menschheit so des Lebens Welt betrachten,
Und hohen Sinn als höhres Leben achten.
