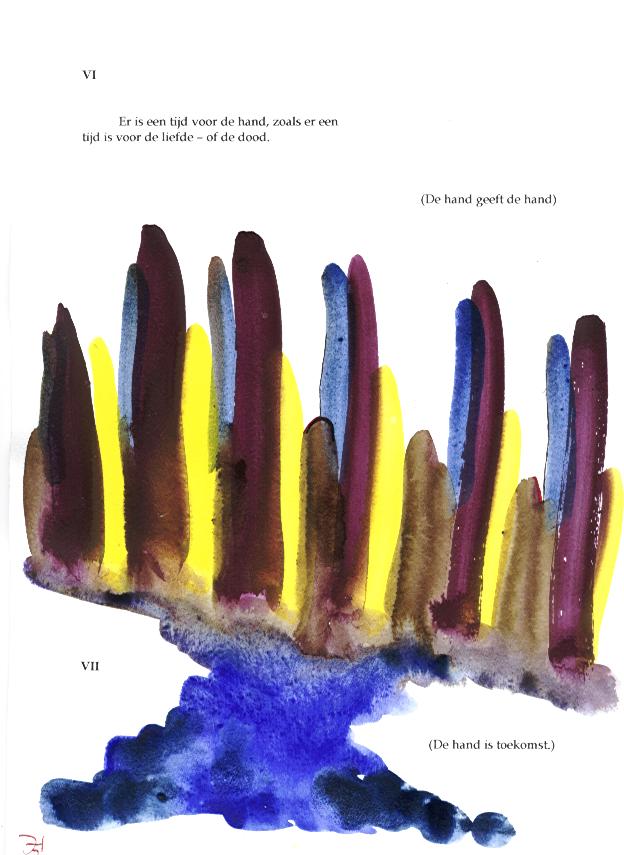Bachmann, Ingeborg, Werke, (4 Bd.) Herausgegeben von Christine Koschel, Inge von Weidenbaum, Clemens Münster, München Zürich 2010, (Piper Verlag)
[Wozu Gedichte?]
Einem Dramatiker oder Erzähler wird die Frage, welche seiner Arbeiten ihm die liebste sei, nicht viel Unbehagen machen; es wird ihm hoffentlich einfallen, dass die eine oder die andere einigen Menschen Freude bereitet, Einsicht gebracht oder sie unterhalten hat – sei’s auch nur ein paar Stunden lang. Ich habe noch nie gehört, dass jemand einem Gedicht einen fruchtbaren Nachmittag oder Abend verdankt, obwohl es zweifellos noch immer Liebhaber von Lyrik gibt und Leute, die sich dran zu erbauen vermögen. Dann gibt es noch die Kinder, die Gedichte auswendig lernen müssen, weil Gedichte -so heisst es – das Gedächtnis schärfen.
In einem Gedicht ist also wenig Glück. Für den, der es schreibt, nahezu keins, dass es gelingt, und dann nochmals keins, dass es jemand erreicht. Es ist einsam, hat keine Funktion und kümmert mit Recht niemand. Ein Gedicht verherrlicht heute ja nichts mehr, und auch die Gläubigen haben es längst ausser Kraft gesetzt. Ruhm und Glaube fallen auf es selbst zurück.
Man hört heute so oft — profaniert — die Hölderlinsche Frage: und wozu Dichter in dürftiger Zeit? Eine andere Frage, nicht weniger berechtigt, wäre: und wozu Gedichte? Was ist zu beweisen und wem ist etwas zu beweisen? Wenn Gedichte ein Beweis zu nichts sein sollten, müssten wir uns dran halten, dass sie das Gedächtnis schärfen. Ich glaube, dass Gedichte dies vermögen und dass, wer Gedichte schreibt, Formeln in ein Gedächtnis legt, wunderbare alte Worte für einen Stein und ein Blatt verbunden oder ‘ gesprengt durch neue Worte neue Zeichen für Wirklichkeit, und ich glaube, dass wer die Formeln prägt, auch in sie entrückt mit seinem Atem, den er als unverlangten Beweis für die Wahrheit dieser Formeln gibt.
Wie lange ist es her, dass man uns sagte: bilde ein Wort, bilde einen Satz! Man quälte uns mit Gedichten; die Kerben schmerzen noch im Gedächtnis. Eines dieser Gedichte begann: “Ich stand an meines Landes Grenzen .. . « Von welchem Ich war die Rede und von welchem Land? Was die Grenzen bedeuteten, ergab sich freilich aus dem Zusammenhang. Denn wer die Regeln gutheisst und in das Spiel eintritt, wirft den Ball nicht übers Spielfeld hinaus. Das Spielfeld ist die Sprache, und seine Grenzen sind die Grenzen der fraglos geschauten, der enthüllt und genau gedachten, der im Schmerz erfahrenen und im Glück gelobten und gerühmten Welt.
Ingeborg Bachmann, Werke 4
Pag 303-304

Grünbein, Durs, Aus der Traum (Kartei). Aufsätze und Notate, Berlin 2019 (Suhrkamp)
Das Punktum des Gedichts
Diese kurze Spanne Leben, der Moment zwischen Nichts und wieder Nichts, und wie alle sich gegenseitig bewachen und kontrollieren, dass möglichst wenig nach draussen ins Transzendente dringt. Zwischen Irgendwo und Nirgendwo dieses kleine Apropos, das sich mit einem Namen schmückt, einem zufälligen Namen. Und daran knüpft sich das Ich? Daran soll sich der Mensch gebunden fühlen ein Leben lang? *
Ich bin an den Gedichten auch darum hängengeblieben, weil mich das Problem des primären Ausdrucks nie losgelassen hat. Etwas unmittelbar zu sagen—jetzt, hier, direkt—in aller Eigensinnigkeit einer (meiner) partikularen Sprache der Poesie, die nicht die der Wissenschaft ist, nicht die der Religion, nicht die des Mythos, nicht die der Philosophie und die mich doch in der Welt zu Hause sein lässt. Die Klärung der dringlichsten Fragen für die Ausdruckskunst (Literatur) ist am ehesten in der Dichtung zu !eisten, scheint mir.
Gedichte aber kann man eigentlich nur im Freien schreiben — draussen, wo das Auge sich in der Betrachtung der Welt vom Diktat der Sprache, die im Gehirn spukt, vonden symbolischen Formen erholt. Sprache, die allein uns allem näherbringt und uns gleichzeitig von allem entfernt.
Durs Grünbein, Aus der Traum (Kartei). Aufsätze und Notate, Berlin 2019 (Suhrkamp), p. 90

Das Gedichteschreiben ist ein paradoxer Vorgang, Sammlung und Auflösung in einem. Wer Gedichte schreibt, kommt sich selbst näher und entfernt sich im selben Schwung wieder von sich. Verse sind ein hochauflösendes Darstellungsmittel der Existenz. Da jeder sich selbst der Nächste ist, braucht es eine Form, die aus dieser Tatsache etwas Mitteilenswertes macht, das jeder verstehen kann, gerade weil es jeden betrifft. lm Idealfall schafft Dichtung das besser als jede andere Weise der Durchsage, wenn auch meist nur in Bruchstücken, augenblickshaft. Das klingt, ich weiss es, nach einer Poetik für Eintagsfliegen. In dieser Fragilität, Kurzatmigkeit, in der ihr eigenen Selbstwidersprüchlichkeit liegt ein seltsamer Trost, der die Menschen im Gedicht erreicht, und sei es nur punktuell. Es liegt auch ein Trost darin. Mich haben Gedichte gerade darum, als Funksignale aus dem Innersten eines einzelnen Lebens, oft trösten können. Die ältesten aus antiken Zeiten genauso wie das jüngste, das ein neugeborener Dichter erst gestern schrieb -in gleich welcher Muttersprache. Es ist der Drang, der sich mitteilt, die Konzentration in der Kunst, sich überhaupt mitzuteilen. »Ich ziehe das Lächerliche des Schreibens dem Lächerlichen des Nicht-Schreibens vor«, schrieb Wislawa Szymborska, die bei unserer kurzen Begegnung in Krakau die ganze Zeit lächelte.
Hoffnung ist eine rückwärts wirkende Kraft. Sie beruht darauf, dass wir gesehen haben, wie alles gekommen ist, und dass die Zerfallsprozesse ihre Zeit brauchen. Die hohen Tempel, die prachtvollen Paläste sind nicht von einem Tag auf den anderen Ruinen geworden. In dieser Langsamkeit des Zerfalls, nach dem Mass der eigenen Lebenszeit gemessen, liegt alle Hoffnung begründet. Oder sagen wir besser: begraben. Sobald der Verfall sich, aus welchen historischen Gründen auch immer, beschleunigt (und Beschleunigung ist das Wesen unserer Zeit), werden auch die letzten Reserven an Hoffnung aufgebraucht. Die Fliehkräfte sind einfach zu gross geworden. Was nun? Die Utopien sterben, selbst die Ewigkeit altert ( Celan).
Durs Grünbein, Aus der Traum (Kartei). Aufsätze und Notate, Berlin 2019 (Suhrkamp), p. 91
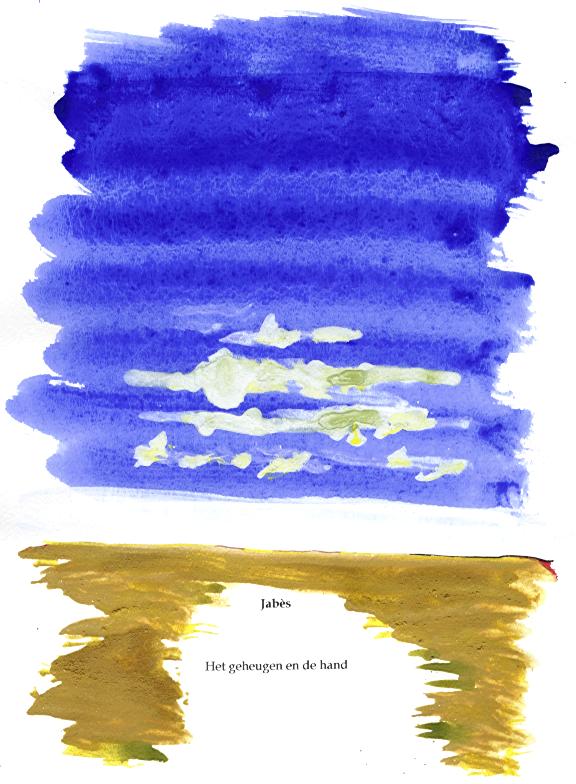
Das Gedicht spricht in gewöhnlicher Sprache. Es kann nicht beanspruchen, eine tiefere Sprache, eine eigentliche Sprache, eine primäre Sprache zu sprechen – es muis sich mit den herkömmlichen Worten begnügen und weiss nicht mehr als der Leser. Dabei ist diese gewöhnliche Sprache, in der das Gedicht spricht, alles andere als trivial, weil es eine Sprache ist, die sich dem Unbekannten zuwendet, die sich den Vielheiten stellt, die so zahlreich sind wie die Subjekte, aus denen sie spricht. Das gleiche gilt für die Worte: Auch sie sind so zahlreich in ihrer Anwendung wie die Kontexte, in denen sie stehen. Die Worte im Gedicht sind alles andere als eindimensional. Vielmehr ist ihre Räumlichkeit durch die Beweglichkeit und den Orientierungssinn ihrer Sprecher gegeben, ob diese nun biographisch bedingt sind (der Wanderer, der Weltreisende, der Abenteurer, der Vertriebene) oder oh sie rein nur der Phantasie entspringen (der Provinzdichter, der Blinde, der regionale Universalist). Dies festzustellen heisst noch nicht viel, aber es könnte der Anfang einer Basistheorie sein, wie sie Wittgenstein in seinen verstreuten Bemerkungen Über Gewisstheit vorführt.
Punktualität ist in Behandlung ihrer Gegenstände der Charakter lyrischer Dichtung. So drückt es, in der Sprache der Systemphilosophie, der Hegelianer Friedrich Theodor Vischer in seiner Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen aus. Die Lyrik, sagt er, kann das Objekt nicht entwickeln, nicht ausbreiten. Ihre Beschränktheit liege schon in der Vereinzelung des Dichters: dass es immer nur dieses eine Subjekt ist, das in dieser einen Situation von einem Punkt aus die Totalität der Welt berührt. Die Lyrik bleibt daher an die Zufälligkeit der Wahrnehmung gebunden. Damit sei auch die Gefahr des Pathologischen gegeben. Hier klingt Goethe an, der im Alter die Poesie als eine Krankheit sah, durch die man hindurchmuss. Wer an ihr hängenbleibt, wer sich im Labyrinth des lyrischen Ausdrucks verirrt, zahlt einen hohen Preis -wie der »arme Hölderlin«. Erst die Gesamtheit der lyrischen Äusserungen, sagt Vischer, ergibt das Bild einer Persönlichkeit. »Meine Gedichte sind meine Vita.« (Paul Celan)
Und dann kommt eine überraschende Definition, die den Vorgang plötzlich ins Licht rückt, eine physikalisch-technische Erklärung der Poesie, avant la lettre. Die lyrische Dichtung sei »punctuelles Zünden der Welt im Subjecte«.
p. 96
Letzte Chance und einzige, etwas zu sagen: das ist das Gedicht. Anscheinend bin ich der mystische Mensch, der an den Augenblick glaubt da etwas sich mitteilt, etwas mitteilenswert ist. Daher die Scheu vor jeder Lesung: Nun ist es wieder soweit, du bist aufgerufen, das Gedicht, das du geschrieben hast, vorzulesen wie etwas vollkommen Neues. Im Lesen musst du es aktualisieren.
In Bildern zu denken, das lnnere wie eine Landschaft zu ergründen, das ist meine Art, vorübergehend Halt zu finden in einer Welt, die immerfort vor den Augen verschwimmt. Ich habe keine Methode (wie sie die Patriarchen der Philosophie für sich beanspruchen), sowenig wie Kinder eine Methode haben, wenn sie den Ausdruck finden, der ihrer Lage entspricht. Ich höre auf, wenn die Gewissheit zu aufdringlich wird, unterbreche mich, wenn die Rede zu glatt dahin-geht. Ich Hebe den Zeilenbruch als Bruch mit der Wirklichkeit, die mich immer umgibt.
p. 96
Durs Grünbein, Aus der Traum (Kartei). Aufsätze und Notate, Berlin 2019 (Suhrkamp)