Lyrisch sein
Warum können wir nicht in uns selbst verschlossen bleiben? Weshalb haschen wir nach Ausdruck und Form, indem wir versuchen, uns der Inhalte zu entleeren und einen chaotischen, rebellischen Vorgang zu systematisieren? Wäre es denn nicht fruchtbarer, uns unserer innerlichen Strömung preiszugeben, ohne an eine Objektivation zu denken, indem wir alle inneren Wallungen und Erregungen mit inniger Wollust aufsaugen? In diesem Falle würden wir mit einer unendlich reicheren Inbrunst jene Steigerung erleben, welche die geistigen Erfahrungen bis zur Überfülle ausweitet. Vielfaltige und ausgeprägte Erlebnisse verschmelzen und entfalten sich zur allerfruchtbarsten Aufwallung. Eine Empfindung unmittelbarer Gegenwart von komplexen seelischen Inhalten entsteht als Ergebnis dieser Steigerung, emporschlagendem Gewoge oder einem musikalischen Paroxysmus gleich. Von sich selbst eingenommen – nicht im Sinne von Dunkel, sondern von Reichtum -, von innerer Unendlichkeit und extremer Spannung gepeinigt sein bedeutet, mit so viel Heftigkeit leben, dass man fühlt, man sterbe wegen des Lebens. Dieses Gefühl ist derart selten und seltsam, dass wir es im Aufschrei erleben müssten. Ich fühle, dass ich wegen des Lebens sterben muss, und frage mich, ob es Sinn hat, nach Erklärungen zu suchen. Wenn die gesamte seelische Vergangenheit in einem Augenblick grenzenloser Anspannung in dir zuckt, wenn eine vollkommene Gegenwart abgeschlossene Erfahrungen wachruft und ein Rhythmus Gleichgewicht und Gleichmaß einbüßt, dann reißt dich der Tod von des Lebens Hohe hinab, ohne dass da das Schaudern in seinem Angesichte verspürst, welches mit der quälenden Obsession des Todes einhergeht. Dieses Gefühl ist jenem der Geliebten analog, wenn ihnen auf dem Scheitel der Seligkeit das Antlitz des Todes flüchtig, aber nachdrücklich erscheint, oder gleicht jenen Augenblicken der Unsicherheit, wenn in eine noch erblühende Liebe sich die Vorahnung ihres Scheiterns oder des Verlassenwerdens einschleicht.
Es gibt wenige, welche derartige Erfahrungen bis zur Neige ertragen können. Der Erhaltung von Inhalten, die nach Objektivierung lechzen, und der Einschließung einer zur Explosion strebenden Energie droht immer ernste Gefahr, weil du einen Zustand erreichen konntest, in dem sich die überschäumende Energie nicht mehr bändigen lässt. Und dann lauert der Zusammensturz aus Überfülle. Es gibt Erlebnisse und Zwänge, mit denen man nicht überleben kann. Ist es denn keine Rettung, sie einzugestehen? Die furchtbare Erfahrung und die zerfleischende Obsession des Todes drohen sich verhängnisvoll auszuwirken, wenn sie im Bewusstsein bewahrt werden. Spricht man über den Tod, so hat man etwas von sich errettet zugleich ist indessen ein Tell des eigenen Wesens erstorben, weil die objektivierten Inhalte ihre Aktualität im Bewusstsein verlieren. Aus diesem Grunde stellt der Lyrismus einen Drang dar, die Subjektivität auszuschütten; weil er auf eine Aufwallung des Lebens im Einzelnen hindeutet, welche – unbezwinglich – unablässig nach Ausdruck heischt. Lyrisch sein bedeutet, nicht in sich selbst verschlossen bleiben können. Die Notwendigkeit sich zu äußern ist umso intensiver, je inniger, abgründiger und dichter der Lyrismus. Weshalb ist denn der Mensch im Leiden und in der Liebe lyrisch? Weil diese Zustände, obgleich in Wesen und Ausrichtung verschieden aus dem tiefsten und intimsten Grunde unseres Wesens aufkeimen, aus dem wesentlichen Kern der Subjektivität, der einer Projektions- und Strahlungszone gleicht. Man wird lyrisch, wenn im Innern das Leben in einem wesentlichen Rhythmus schlägt und das Erleben so mächtig ist, dass es den ganzen Sinn unserer Persönlichkeit umfangt. Unsere Einzigartigkeit und Eigenheit gewinnen eine derart ausdrucksvolle Gestalt, dass das Individuelle die Ebene des Universalen erklimmt. Die tiefsten Erfahrungen sind auch die universalsten, weil in ihnen der Urgrund des Lebens berührt wird. Die wahre Verinnerlichung führt zu einer Universalität, welche den am Rande Verharrenden unzugänglich ist. Die vulgäre Deutung der Universalität erblickt darin eher eine in Ausdehnung bestehende Komplexität als eine qualitative, reiche Umfassung. Deshalb betrachtet sie den Lyrismus als periphere und minderwertige Erscheinung, als Spross geistiger Haltlosigkeit, anstatt zu erkennen, dass die lyrischen Borne der Subjektivität eine äußerst bemerkenswerte innerliche Frische und Tiefe erahnen lassen.
Es gibt Menschen, die nur in den entscheidenden Augenblicken ihres Daseins lyrisch werden; manche nur im Todeskampf, wenn sich ihre gesamte Vergangenheit vergegenwärtigt und sie wie ein Sturzbach überflutet. Die meisten werden es jedoch infolge wesentlicher Erfahrungen, wenn die
Erregung ihres innersten Wesensgrundes zum Paroxysmus gelangt. Die Menschen jedoch, die zur Objektivität und Unpersönlichkeit neigen – sich selbst und den abgrundtiefen Wirklichkeiten fremd -, erfahren als Gefangene der Liebe ein Gefühl, das alle Schichten ihrer Persönlichkeit aufwühlt. Die Tatsache, dass alle Menschen dichten, wenn sie lieben, beweist, dass ihre Mittel des begrifflichen Denkens allzu karg sind, um innerliche Uferlosigkeit auszudrücken, und dass der innere Lyrismus nur in unfasslichem und untergründigem Fließen den angemessenen Objektivationsmodus findet. Tritt bei der Erfahrung des Leidens denn kein analoger Fall ein? Du ahntest niemals, was da in dir verbirgst und was das Leben in sich birgt; du lebtest zufrieden und am Rande, als die nach der Erfahrung des Todes (in Gestalt eines Vorgefühls zu sterben) grimmigste Erfahrung, nämlich diejenige des Leidens, sich deiner bemächtigte und dich zu einem unendlich komplexeren Daseinsbereich hinanführte, in dem sich deine Subjektivität wie in einem Wirbel walzt. Aus Leiden lyrisch sein bedeutet, jene Glut und Läuterung zu erfahren, in welchen die Wunden aufhören, lediglich äußerliche Erscheinungen ohne tiefere Komplikationen zu sein, sondern am Kern unsres Wesens teilhaben. Der Lyrismus ist ein Gesang des Blutes, des Fleisches und der Nerven. Nur jene, die in skandalöser Unempfindlichkeit dahinvegetieren, bleiben im Falle einer Krankheit, die stets eine persönliche Vertiefung verwirklicht, unpersönlich.
Nur im Gefolge eines durchdringenden und organischen Gebrechens wird man lyrisch. Der zufällige Lyrismus entspringt äußeren Bestimmungen, und in dem Masse, wie sich diese verflüchtigen, verschwindet auch ihre innere Entsprechung. Es gibt keinen echten Lyrismus ohne ein Fünkchen
inwendigen Wahnsinns. Bezeichnenderweise ist der Anfang der Psychosen durch eine lyrische Phase gekennzeichnet, in der alle gewöhnlichen Hindernisse und Grenzen sich auflösen, um einem höchst fruchtbaren Rausch zu weichen. Auf diese Weise wird die poetische Ergiebigkeit auf den ersten Stufen der Psychose erklärlich. Der Irrsinn konnte lyrischer Paroxysmus sein. Deshalb begnügen wir uns auch, das Lob des Lyrismus anzustimmen, um es nicht dem Wahnsinn zu widmen. Der lyrische Zustand liegt jenseits der Formen und Systeme. Ein Fluidum, ein innerliches Aufwogen verschmilzt alle Teile des Innenlebens in einem einzigen Elan – gleichsam in idealem Zusammenstreben – und lässt einen inbrünstigen und überquellenden Rhythmus erstehen. Angesichts einer in Formen und Schranken erstarrten Kultur, welche alles vermummt, ist der Lyrismus urgewaltiger Ausdruck. Sein Wert liegt denn auch eigentlich darin, barbarisch zu sein, mithin nur aus Blut, Aufrichtigkeit und Lohen zu bestehn.
13-15
Allem entrückt!
Ich weiß überhaupt nicht, weshalb wir hienieden etwas tun, warum wir Freunde und Bestrebungen, Hoffnungen und Träume haben müssen. Ware es denn nicht besser, sich in einen abgelegenen Winkel zurückzuziehen, wohin nichts mehr vom Widerhall dessen, woraus sich das Gedröhn und Gewirre dieser Welt zusammensetzt, dringt? Wir würden sodann auf Kultur und Ambitionen verzichten, alles verlieren und nichts gewinnen. Aber was gibt es in dieser Welt schon zu gewinnen? Einige, denen jedweder Gewinn nichts bedeutet, sind heillos unglücklich und einsam. Alle sind wir einander so verschlossen! Und wenn wir so offen waren, dass wir alles vom Andern empfingen oder ihm bis in die Seelenabgründe schauten, um wieviel mehr wurden wir ihm sein Schicksal denn aufhellen? Wir sind im Leben so einsam, dass man sich fragt, ob die Einsamkeit der Agonie nicht überhaupt ein Symbol des menschlichen Daseins sei. Es ist ein Anzeichen großer Schwache, in Gesellschaft leben und sterben zu wollen. Kann es denn in den allerletzten Momenten noch Lichtblicke geben? Es ist besser, irgendwo einsam und verlassen zu sterben: den Blicken entzogen, kann man ohne Posen und Possen verloschen. Mich widern die Menschen an, welche sich in der Agonie noch beherrschen und sich Attitüden auferlegen, um Eindruck zu machen. Die Tränen glühen nur im Alleinsein. Alle, welche in der Agonie von Freunden umringt sein wollen, handeln aus Angst und dem Unvermögen, die letzten Atemzüge zu ertragen. Im entscheidenden Augenblick wollen sie den Tod vergessen. Weshalb beseelt sie denn kein maßloser Heroismus, warum verriegeln sie nicht alle Türen, um jene schauerlichen Empfindungen mit einer Luzidität und Furcht jenseits
aller Grenzen zu erdulden?
Wir sind von allem getrennt! Und ist nicht alles Seiende unerreichbar? Das tiefe und organische Sterben ist der Tod in Einsamkeit, wenn selbst das Licht zum Todesprinzip wird. In solchen Momenten bist du vom Leben, von der Liebe, vom Lächeln, von den Freunden und sogar vom Tode losgelöst. Und du fragst dich paradoxerweise, ob es noch etwas außer deiner und der Welten Leere gebe.
16

Nicht mehr leben können
Es gibt Erfahrungen, die man nicht überleben kann. Darnach fühlt man, dass alles, was man auch täte, keine Bedeutung mehr haben kann. Denn nachdem man die Grenzen des Lebens erreicht, nachdem man alles, was jene gefahrenreichen Gestade bieten, in Verzweiflung durchlebt hat, büßen die alltäglichen Gebärden und das gewöhnliche Streben jeglichen Reiz und jede Verlockung ein. Wenn du trotz allem überlebst, ist es doch dem Objektivationsvermögen zu verdanken, vermittels welchen du jene unermessliche Spannung schreibend abschüttelst. Schöpfertum ist nur eine zeitweilige Rettung aus den Klauen des Todes.
Mir ist, als müsste ich wegen allem, was mir das Leben zu bieten vermag, und auch wegen der Aussicht auf den Tod bersten. Ich spare, dass ich sterbe: aus Einsamkeit, Liebe, Hass und wegen allem, was die Erde mir darreicht. Es ist, als ob ich mich in jedem Erlebnis wie ein Ballon – weit über meine Widerstandsfähigkeit hinaus – aufblähte. In der schrecklichsten Intensivierung vollzieht sich eine Konversion ins Nichts. Du schwillst innerlich an, steigerst dich zum Wahnsinn, bis an den Rain des von der Nacht entführten Lichts, bis alle Schranken zerrinnen: und aus jener Überfülle schleudert dich ein bestialischer Wirbel unmittelbar ins Nichts hinab. Das Leben entfaltet Fülle und Leere, Überschwang und Depression; was sind wir denn schon angesichts des inneren Wirbels, der uns bis zur Absurdität ausrenkt? Ich fühle, wie das Leben in mir vor allzu ungebärdiger Inbrunst pocht, aber auch, wie es vor zufiel Ungleichgewicht kracht. Es ist wie eine Explosion, die sich kaum zügeln lasst und auch dich unwiederbringlich in die Luft zu jagen vermag. An den Grenzscheiden des Daseins merkst du, dass du deines Innenlebens nicht mehr Herr werden kannst, dass die Subjektivität ein Trugbild ist und dass Kräfte in dir brodeln, die du nicht verantworten kannst, deren Entwicklung in keinem Verhältnis zur Zentrierung der Persönlichkeit oder zu einem bestimmten individualisierten Rhythmus steht. Was erscheint an den Ufern des Lebens nicht alles als Anlass zum Tode? Man stirbt wegen allem, was ist, und allem, was nicht ist. Jedes Erlebnis ist in diesem Falle ein Sprung ins Nichts. Wenn du alles, was dir das Leben dargeboten hat, bis zum Paroxysmus, zur äußersten Anspannung durchlebst, ist jener Zustand erreicht, in dem du nichts mehr erleben kannst, weil dir nichts mehr bleibt. Selbst wenn da diese Erlebnisse nicht nach allen Richtungen durchlaufen hast, es genügt, die wichtigsten aufs Äußerste getrieben zu haben. Und wenn du dich aus Einsamkeit, Verzweiflung oder Liebe sterben fühlst, bilden die anderen Erlebnisse ein unendlich schmerzendes Trauergefolge. Die Empfindung, nach derartigen Schwindelanfällen nicht mehr leben zu können, ergibt sich aus innerer Verzehrung. Des Lebens Flammen züngeln in einem geschlossenen Herd, aus dem die Glut nicht entweichen kann. Die Menschen, die auf einer äußeren Ebene leben, sind von vornherein erlöst; aber was können sie schon hinüberretten, kennen sie doch keinerlei Fahrnisse? Der Paroxysmus der Innerlichkeit und des Erlebens fuhrt dich In ein Gefilde, wo die Gefahr absolut ist, weil das Dasein, das im Erleben mit angespanntem Bewusstsein seiner Wurzeln gewahr wird, sich selbst verneint. Das Leben ist allzu begrenzt und fragmentarisch, um gewaltigen Spannungen standzuhalten. Überkam denn nicht alle Mystiker das Gefühl, nach großen Ekstasen das Leben nicht mehr fortsetzen zu können? Was sollten jene, deren Empfindungen das Normale sprengen, noch von dieser Welt erwarten: Leben, Einsamkeit, Verzweiflung oder Tod?
17-18
Die Leidenschaft für das Absurde
Es gibt keinerlei Argumente für das Leben. Kann einer, der das Äußerste erreicht hat, fortan noch mit Argumenten, Ursachen, Wirkungen, moralischen Betrachtungen umgehen? Gewiss nicht. Jenem bleiben nur noch unmotivierte Grunde, um zu leben. Auf der Verzweiflung Höhe wirft die Leidenschaft fürs Absurde als einzige noch dämonisches Licht auf das Chaos. Wenn alle landläufigen Ideale – ethische, ästhetische, religiöse, soziale – das Leben nicht mehr zu leiten imstande sind und ihm auch kein Ziel mehr zu setzen vermögen, wie kann das Leben sich dann vor der Nichtswerdung noch bewahren? Nur durch Festhalten am Absurden, durch die Liebe des absolut Sinnlosen, das heißt durch etwas, dem die Konsistenz abgeht, das gleichwohl durch seine Fiktion einen Schein von Leben zu erwecken vermag.
Ich lebe, weil die Berge nicht lachen und das Gewürm nicht singt. Die Leidenschaft für das Absurde kann nur in einem Menschen entstehen, in dem alles sich aufgelöst hat und in dem sich dennoch befruchtende Verklärungen ankündigen können. Demjenigen, der alles verloren hat, bleibt nur noch die Passion für das Absurde. Denn was konnte ihn am Dasein noch beeindrucken? Welchen Versuchungen konnte er noch erliegen? Einige meinen: der Selbstaufopferung für die Humanität, dem Gemeinwohl, dem Kult des Schonen … Mir gefallen nur jene, die mit alledem – und sei es auf kurze Zeit- gebrochen haben. Nur sie haben absolut gelebt. Nur sie haben das Recht, über das Leben zu reden. Man kann zur Liebe und zur Heiterkeit zurückkehren. Aber man kehrt durch Heldenmut zurück, nicht durch Bewusstlosigkeit. Eine Existenz, die keinen monströsen Wahnsinn in sich birgt, hat keinerlei Wert. Denn wodurch unterscheidet sie sich vom Dasein eines Steins, eines Klotzes oder einer Fäulnis? Aber ich sage euch: Mächtiger Wahnsinn ist vonnöten, um Stein, Klumpen oder fauliger Abhub werden zu wollen. Nur wenn du alle giftigen Genüsse des Absurden ausgesogen hast, bist du vollkommen geläutert, weil du nur dann der Auflösung den allerletzten Ausdruck aufprägst. Und ist nicht jeder letzte Ausdruck Absurd?
*
Manchen Menschen ist es vergönnt, einzig und allein das Gift der Dinge auszukosten; ihnen ist jede Überraschung schmerzlich, jede Erfahrung erneuter Anlass zur Tortur. Wenn man behauptet, dass dieses Leiden subjektive Gründe habe, die von einer besonderen Konstitution abhängen, so frage ich: Gibt es irgendein objektives Kriterium zur Bewertung des Leidens? Wer konnte denn genau angeben, dass mein Nachbar mehr als ich leidet oder dass Jesus mehr als wir alle gelitten hat? Es gibt kein objektives Maß, weil es sich nicht nach der äußeren Exzitation oder der lokalen Indisposition ansetzen lasst, sondern nach der Art, wie das Leid im Bewusstsein empfunden und reflektiert wird. Nun ist aber aus diesem Blickwinkel die Aufstellung einer Hierarchie undenkbar. Jeder Mensch verharrt in seinem Leiden, das ihn absolut und unermesslich dünkt. Und wenn man bedachte, wieviel die Menschheit bisher gelitten hat, wenn man an die grässlichen Sterbestunden und die kompliziertesten Qualen, die grausamsten Todesarten und die schmerzlichste Verlassenheit dachte und aller Pestkranken, aller bei lebendigem Leibe Verbrannten oder vom Hunger Ausgelöschten gedachte, um wieviel würde sich unser Leiden verringern?
Auf dem Sterbelager wird beim Gedanken niemand getröstet, dass alle sterblich sind, ebensowenig wie ein Leidergriffener im vergangenen oder gegenwärtigen Leiden der Andern Trost finden wird. Denn in dieser organisch insuffizienten und fragmentarischen Welt ist der Einzelne geneigt, ganzheitlich zu leben, und trachtet darnach, sein Dasein zum Absoluten emporzuheben. Jede subjektive Existenz ist ein Absolutes an sich. Deshalb lebt jeder Mensch, als wäre er der Nabel des Universums oder Mittelpunkt der Geschichte; wie sollte das Leid denn kein Absolutes sein? Ich kann das Leiden eines Andern nicht verstehen wollen, um dadurch mein eigenes zu vermindern. Vergleichungen sind in solchen Fällen sinnlos, weil das Leiden ein Zustand innerlicher Einsamkeit ist, dem nichts Äußeres beizustehen vermag. Es ist ein beachtlicher Vorteil, einsam leiden zu können. Wie wäre es denn, wenn das menschliche Antlitz das gesamte inwendige Leid angemessen auszudrücken vermochte, wenn die ganze innere Pein sich im Gesichtsausdruck objektivierte? Konnten wir uns dann noch miteinander unterhalten? Müssten wir uns- nicht beim Reden das Angesicht mit den Händen verbergen? Das Leben wäre wahrlich unmöglich, wenn unser unversiegliches Empfindungsvermögen sich in des Gesichtes Fürchen entblößen würde.
Niemand würde es wagen, sich im Spiegel zu betrachten, weil ein groteskes und zugleich tragisches Bild unter den Umrissen der Physiognomie Schandflecken und Blutspuren, aufgerissene, nicht vernarbende Wunden, nicht einzudämmende Tränenströme vermischen würde.
Eine grausige Wonne würde mich ergreifen, sobald ich sähe, wie in der bequemen und oberflächlichen Harmonie des Alltags ein Blutvulkan ausbricht, feuerrote, wie Verzweiflung sengende Strahlen hervorstürzen, wie sich die klaffenden Wunden unseres Wesens auftun, um uns in blutende Eruption zu verwandeln. Nur dann würden wir die Vorteile der Einsamkeit, die unser Leiden stumm und unzugänglich macht, begreifen und schätzen lernen. Würde nicht alles aus den Dingen herausgesogene Gift in einem Blutauswurf, in einem Vulkan unseres Wesens ausreichen, um die gesamte Welt zu verseuchen? Das Leiden trieft von Gift und Galle!
*
Wahre Einsamkeit ist nur jene, in welcher du dich zwischen Himmel und Erde vollkommen allein und verloren fühlst. Nichts lenke die Wachsamkeit von diesen Erscheinungen absoluten Entbundenseins ab, sondern eine Eingebung von erschütterndem Scharfblick entschleiere das gesamte Drama der Endlichkeit des Menschen angesichts der Unendlichkeit und Nichtigkeit des Weltalls. Die einsamen Wanderungen – dem Innenleben äußerst fruchtbar und gefährlich zugleich – müssen also unternommen werden, damit nichts von dem, was die Vision der Verlassenheit des Menschen in der Welt trüben konnten, in die Geschäfte des Einzelnen eindringt. Um den Vorgang der Verinnerlichung und der Konversion zur eigenen Wesenheit zu intensivieren, ist das einsame Wandern nur in den Dämmerstunden fruchtbar, wenn die üblichen Reize die Aufmerksamkeit nicht mehr rauben können und in der tiefsten Schicht des Geistes die Offenbarungen über die Welt aufgehen – wo sich der Geist vom Leben, von der Daseinswunde geschieden hat. Wieviel Einsamkeit tut not, um Geist zu erwerben? Wieviel Tod im Leben und wie viele Feuersbrünste im Innern? Die Einsamkeit verneint so viel Leben, da8 die aus den Lebensverrenkungen hervorgeschossene Blüte des Geistes fast unerträglich zu werden droht. ist es denn nicht bezeichnend, dass jene sich wider den Geist auflehnen, die allzu viel Geist besitzen, die wissen, wie tief Krankheit das Leben durchbohrte, um den Geist zu gebaren? Der Geist wird von gesunden und feisten Menschen verherrlicht, die keine Ahnung haben, was Geist bedeutet, die niemals der Folter des Lebens ausgesetzt gewesen sind und die beißenden Antinomien am Daseinsgrunde nie erfahren haben. Wer den Geist wirklich gefühlt hat,
duldet ihn hochmutig oder empfindet ihn als Plage. Niemand ist jedoch in seines Herzens Grunde von dieser dem Leben verderblichen Errungenschaft, welche der Geist darstellt, begeistert. Und wie sollte ihn dieses Leben ohne Reiz, ohne Naivität und ohne Spontaneität auch entzücken?
Die Gegenwart des Geistes zeigt immer ein Defizit an Leben, viel Einsamkeit und langwieriges Leiden an. Wer spricht denn von Erlösung durch den Geist? Es ist keineswegs wahr, dass das Leben auf der immanenten Ebene des Daseins angsterfüllt gewesen und der Mensch ihm durch den Geist entwachsen sei. Wahr ist, im Gegenteil, dass durch Geist Ungleichgewicht, Beklommenheit, aber auch Große errungen wurden. Was sollen denn jene, die nicht einmal die Gefahren des Lebens kennen, von den Fahrnissen des Geistes verstehen? Es ist ein Anzeichen unmäßiger Bewusstlosigkeit, sich zum Verfechter des Geistes aufzuwerfen, so wie es ein Symptom großer Unausgeglichenheit ist, das Leben zu rechtfertigen. Denn dem normalen Menschen ist das Leben evident; nur der Dahinsiechende begeistert sich und lobpreist es, um nicht zusammenzusinken. Was wird aber aus jenem, der weder das Leben noch den Geist lobpreisen kann?
19-22

Ich und die Welt
Die Tatsache, dass ich lebe, beweist, dass die Welt keinen Sinn hat. Denn wie könnte ich in der Ruhelosigkeit eines übermäßig erregten und unglücklichen Menschen, für den sich alles letztlich auf das Nichts beschränkt und über dem das Leiden als Weltgesetz waltet, einen Sinn aufspüren? Wenn die Schöpfung ein Menschenwesen meines Schlages zugelassen hat, kann dies nur beweisen, dass die Flecken der sogenannten Sonne des Lebens derart gewaltig sind, dass sie ihr Licht allgemach ersticken. Die Bestialität des Lebens hat mich zertreten und gedrückt, mir die schwebenden Schwingen gestutzt und alle Freuden, auf welche ich ein Recht hatte, entrissen. Alle überspannte Beflissenheit und alle irrsinnige, paradoxe Leidenschaft, die ich daransetzte, um im Diesseits zu glänzen, aller teuflische Zauber, den ich verbrauchte, um mir einen künftigen Nimbus zu erwerben, und der ganze Elan, den ich auf eine organische Wiedergeburt oder innerliche Morgenrote verschwendete, haben sich als schwächer erwiesen als die Bestialität und Urgründigkeit dieser Welt, welche alle ihre Vorräte an Verderbnis und Gift in mich ausgegossen hat. Das Leben halt hohen Temperaturen nicht stand. Deshalb bin ich zum Schluss gelangt, dass die unruhigsten Menschen, mit ihrer inneren, paroxystischen Dynamik, welche die gewöhnliche Temperatur nicht akzeptieren können, zum Zusammenbruch ausersehen sind. Es steckt ein Aspekt der Dämonie des Lebens im Ruin derer, die unter gewöhnlichen Himmelsstrichen leben, aber auch ein Aspekt seiner Unzulänglichkeit, der erklärt, weshalb das Leben ein Vorrecht der Mittelmäßigen ist. Nur Durchschnittsmenschen leben bei normaler Temperatur; die Andern reiben sich bei Temperaturen auf, welche das Leben aushöhlen, bei denen sie nur mit einem Bein im Jenseits stehend atmen können. Ich vermag der Welt nichts zu geben, weil ich eine einzige Methode besitze: die agonale Methode. Ihr beklaget euch, dass das Menschengeschlecht böse, rachsüchtig, undankbar und gleisnerisch sei? Dann schlage ich euch die
Methode der Agonie vor, mit der ihr euch zeitweilig aller dieser Laster entledigen könnt. Wendet die Methode getrost bei jeder Generation an: die Wirkungen werden unmittelbar sichtbar sein. Vielleicht kann auf diese Weise auch ich der Menschheit von Nutzen sein!
Durch Geißel, Feuer oder Injektionen treibt ihr jeden Menschen in die Agonie, führt ihn hin zur Erfahrung der letzten Augenblicke, auf dass er in grauenvoller Marter der großen Läuterung aus der Todesvision teilhaftig werde. Befreiet ihn sodann und lasset ihn vor Entsetzen rasen, bis er erschöpft zu Boden stürzt. Ich versichere euch, dass die Wirkung unvergleichlich wertvoller sein wird als alle mit üblichen Mitteln erzielten. Wenn ich nur konnte, würde ich die gesamte Schöpfung in Agonie versetzen, um des Lebens Wurzeln von Grund auf zu läutern, sie mit weißglühenden und einschmeichelnden Flammen zu entzünden, jedoch nicht am sie zu zerstören, sondern am sie mit frischem Saft und unverbrauchter Glut zu beleben. Der Weltbrand, den ich entfachen wollte, würde nicht Trümmer, sondern kosmische, wesentliche Verklärung abwerfen. Auf diese Weise würde sich das Leben an höhere Temperaturen gewöhnen und keinen Nährboden mehr für Mittelmäßigkeit abgeben. Und vielleicht wäre in diesem Traume auch der Tod dem Leben nicht mehr immanent. (Zeilen, die ich heute, am 8. April 1933, da ich zweiundzwanzig Jahre alt werde, geschrieben habe. Mir ist seltsam zumute, wenn ich bedenke, dass ich bereits zu einem Spezialisten des Todes geworden bin.)
23-24
Erschöpfung und Agonie
Kennt ihr die schaudervolle Empfindung des Auftauens, wenn man fühlt, als verausgabe man sich, um wie ein Fluss zu fluten, wenn die eigene Gegenwart in organische Auflösung umschlagt? Es ist, als ob alle deine Konsistenz und Substanz zerflossen und dir nur noch das Haupt erhalten bliebe. Ich meine dabei eine ganz deutliche und schmerzvolle Empfindung, keine vage und verschwommene. Du spürst, wie von dir einzig und allein der Schädel zurückgeblieben ist; ein Schädel ohne Substrat und Fundament, des Leibes ledig und wie in einer Halluzination entrückt. Es ist nicht jene wonnige und unbestimmte Mattigkeit, die man bei der Kontemplation am Meeresgestade oder in mancher melancholischen Träumerei erfahrt, sondern eine Ohnmacht, welche dich erschöpft und verwüstet. Dann sagt dir keine Anstrengung, keine Hoffnung und keine Chimäre mehr zu. Von deinem eigenen Unheil betäubt, unfähig zu handeln oder zu denken, von einer eisigen und bleiernen Düsternis umhüllt, verlassen wie in nächtlichen Halluzinationen oder einsam wie in den Augenblicken der Zerknirschung sein heißt, den negativen Lebensrand, die absolute Temperatur erreichen, wo der letzte Trug des Lebens erstarrt. Und in diesem Erschöpfungszustand wird der wahre Sinn der Agonie offenbar, denn diese ist kein eingebildeter Kampf und keine nichtige Leidenschaft, sondern das aussichtslose Zucken des Lebens in den Krallen des Todes. Man kann die Agonie kaum von der Ermattung und vom Sterben trennen. Todes röcheln als Kampf? Ein Kampf mit wem und am was? Die Auslegung der Agonie als von der eigenen Sinnlosigkeit entbrannter Elan oder als aufwühlende Unstäte mit selbständiger Finalität ist durchaus irrig. Im Grunde bedeutet die Agonie Aufruhr zwischen Leben und Tod. Weil indessen der Tod dem Leben immanent ist, wird beinahe das ganze Leben zur Agonie. Ich bezeichne hingegen nur die dramatischen Momente dieses Kampfes zwischen Leben und Tod als agonal, weil in ihnen die Gegenwart des Todes bewusst und schmerzlich erlebt wird. In der wahren Agonie verflüchtigst du dich durch den Tod ins Nichts, das Gefühl des Erschöpftseins zehrt dich restlos auf, und der Tod obsiegt. Jeder echten Agonie wohnt ein Triumph des Todes inne, selbst dann, wenn man die Erschöpfung überlebt.
Wird in dieser Zerrüttung etwa ein Scheinkampf ausgetragen? Geht nicht jede Agonie mit der Endgültigkeit schwanger? Gleicht sie nicht einer Krankheit, der wir uns zwar nicht mehr zu entreißen vermögen, die uns aber mit Unterbrechungen peinigt? Die agonalen Momente kündigen ein Vorrücken des Todes im Leben an, ein Bewusstseinsdrama, das aus einer Störung des Gleichgewichtes zwischen Leben und Tod erwächst. Sie sind nur in den Zuständen der Erschöpfung möglich, welche das Leben auf das absolute Nichtsein herabdrücken. Die Häufigkeit agonaler Augenblicke ist ein Gradmesser der Zersetzung und des Zusammenbruchs. Der Tod ist ekelhaft, er ist die einzige Obsession, die uns nicht Wollust einflößt. Selbst wenn du sterben willst, tust du es mit dem unausgesprochenen Bedauern deines Wunsches. Ich will sterben, bereue es jedoch, sterben zu wollen. Dies ist die Stimmung aller, die dem Nichts anheimfallen. Das Gefühl des Sterbens ist überhaupt das perverseste. Und wenn man bedenkt, dass es Menschen gibt, welchen dieses perverse Sterbensgefühl den Schlaf raubt! Wie sehne ich mich danach, diese Welt zu vergessen!
25-26
Das Groteske und die Verzweiflung
Unter den mannigfaltigen Gestalten des Grotesken erscheint mir jene am sonderbarsten und kompliziertesten, welche in Verzweiflung wurzelt. Die anderen Zielen auf einen peripheren Paroxysmus. Allerdings ist, und das ist wichtig, das Groteske ohne Paroxysmus nicht vorstellbar. Und welcher Paroxysmus ist tiefer und organischer als derjenige der Verzweiflung? Das Groteske erscheint nur im Paroxysmus negativer Zustände, wenn gewaltige Unruhen an einem Lebensdefizit zehren: es ist eine der Negativität entquollene Exaltation.
Und steckt kein übermütiger Hang zur Negativität in jener bestialischen Grimasse, wenn die Züge und Umrisse des Angesichts sich zu Formen befremdlicher Ausdruckskraft verzerren, wenn entlegene Lichter und Schatten den Blick blenden und das Gemüt den Windungen derartiger Verkrampfungen folgt? Wirklich beklemmende und heillose Verzweiflung kann sich nur in grotesken Ausdrucksweisen objektivieren. Denn das Groteske ist die absolute Negation der Heiterkeit, dieses Zustandes der Lauterkeit, Transparenz und Luzidität weitab von der Verzweiflung, die zuallererst das Chaos und das Nichts gebiert.
Habt ihr jemals die bestialische und verblüffende Befriedigung erlebt, euch nach unzähligen durchwachten Nachten im Spiegel zu betrachten? Habt ihr die Folterpein der Schlaflosigkeit erlitten, wenn ihr Nacht am Nacht Augenblicke zahlt, wenn ihr auf der Welt allein bleibt, wenn euer inneres Drama sich zum wesentlichsten der Geschichte ausweitet und diese Geschichte weder irgendeine Bedeutung hat noch überhaupt existiert, wenn die verheerendsten Feuersbrünste in euch emporlodern und euer Dasein einsam und verloren in einer Welt erscheint, die nur erschaffen wurde, um an eurer Agonie zu zehren? Habt ihr diese zahllosen – und wie das Leiden unendlichen – Augenblicke wahrgenommen, so dass ihr das Groteske bei der Selbstbetrachtung erkennen könnt? Es ist eine allgemeine Verkrampfung, eine Fratze, eine Anspannung der letzten Augenblicke, der sich eine Bleiche von dämonischem Reiz zugesellt: die Todesblässe eines durch die grausigsten Schlünde der Finsternis Hindurchgegangenen. Und gleicht dieses Groteske, das wie ein Ausdruck von Verzweiflung aufblüht, nicht einem Abgrund? Hat es nichts vom abgründigen Wirbel schwindelerregender Tiefen, von jener Versuchung des Unendlichen, das sich vor uns auftut, um uns zu verschlingen, und dem wir uns wie einem Fatum ergeben?
Wie heilsam es für dich wäre, dich in eine unendliche Leere stürzen zu können, um von hinnen zu scheiden! Die Komplexität des aus der Verzweiflung emporgetauchten Grotesken beruht auf seiner Fähigkeit, innere Uferlosigkeit und einen Paroxysmus äußerster Spannung anzudeuten. Wie konnte sich der Paroxysmus denn noch in geschmeidig dahin schlängelnden Linien oder in der Reinheit der Umrisse objektivieren? Das Groteske verneint das Klassische grundsätzlich, so wie es jede Idee von Stil, Harmonie und Vollendung verschmäht.
Denn es verbirgt zumeist intime Tragödien, die man nicht unmittelbar ausdrucken darf; dies leuchtet nur jenem ein, der die vielfältigen Gestalten der innerlichen Dramatik erfasst. Wer sein Antlitz in grotesker Hypostase erschaut, wird nie mehr in sich hineinblicken, denn er wird vor sich selbst erschaudern. Der Verzweiflung folgt eine höchst peinigende Unruhe. Und vergegenwärtigt und verstärkt das Groteske die Bangigkeit und die Unstäte nicht nur noch?
27-28
Die Vorahnung des Wahnsinns
Die Menschen werden niemals begreifen, weshalb einige von ihnen um den Verstand kommen müssen, warum es das Eingehen ins Chaos gibt wie ein unerbittliches Los, ein Chaos, in dem die Luzidität nicht langer wahren kann als ein Blitzschlag. Die inspiriertesten Seiten, die absoluten Lyrismus ausschwitzen, in dem du vom vollkommenen Rausch des Seins gefesselt wirst, können nur in einer derartigen Nervenspannung geschrieben werden, dass eine Umkehr zum Gleichgewicht vergeblich scheint. Solche Anspannungen kann man nicht mehr normal überleben. Der intime Urquell des Wesens halt die natürliche Entwicklung nicht mehr aufrecht, und die Konsistenz der inneren Schranken wird aufgeweicht. Das Vorgefühl des Wahnsinns zeigt sich erst nach tiefgreifenden und entscheidenden Erfahrungen. Du gerätst ins Wanken, als hattest du dich in schwindelerregende Hohen emporgeschwungen, und büßt die Sicherheit und die normale Empfindung konkreter Unmittelbarkeit ein. Eine Schwere scheint dir auf dem Gehirn zu lasten und es einzuzwängen, um es zum Truggebilde herabzudrücken, obgleich nur diese Empfindungen die Richterliche organische Wirklichkeit, aus der alle unsere Erfahrungen hervorquellen, bloßlegen. Und in dieser Bedrängnis, welche dich zu Boden schmettern oder in die Luft sprengen will, dringt das Grausen hervor, dessen Elemente in einem derartigen Fall schwerlich definiert werden können. Es ist nicht jenes beharrliche und obsessive Schaudern vor dem Tode, das sich des Menschen bemächtigt und ihn bis zur Erstickung würgt, das sich in unseren Wesensrhythmus einschleicht, um den Lebensvorgang in uns aufzulösen, sondern ein von Blitzen durchzucktes Schaudern, das selten, aber heftig wie eine jähe Raserei hervorbricht und die Möglichkeit der ungetrübten Klarheit endgültig ausloscht. Es ist unmöglich, diese eigentümliche Vorahnung des Wahnsinns zu erläutern oder genauer zu erfassen. Was wirklich entsetzlich an ihr ist, rührt von daher, da8 wir einen Verlust an Leben ahnen und bereits bei Lebzeiten fühlen, wie uns alles entgleitet. Ich atme oder esse zwar weiterhin, bin jedoch alles dessen, was ich den biologischen Funktionen hinzugefügt habe, verlustig gegangen. Es ist nur ein annähernder Tod. Im Wahnsinn kommt das Spezifische, das dich im Universum kennzeichnet, abhanden, deine einzigartige Perspektive und eine bestimmte Bewusstseinsausrichtung entfliehen. Der Tod entreißt dir alles, dieser Verlust aber entsteht durch den Sturz ins Leere. Deshalb ist die Furcht vor dem Tode zwar beharrlich und wesenhaft, gleichwohl weniger sonderbar als die Furcht vor dem Wahnsinn, in der unsere entzweite Gegenwart eine beträchtlich komplexere Ruhelosigkeit aufweist als die organische Angst vor einer vollkommenen Abwesenheit aus dem Nichts, in das uns der Tod hineinstößt. Und sollte der Irrsinn denn kein Entrinnen aus dem Elend des Lebens sein? Diese Frage kann lediglich theoretisch gerechtfertigt werden, denn einem Menschen, der an gewissen Ängsten leidet, erscheint das Problem in völlig anderem Lichte oder, besser, Dunkel. Die Vorahnung des Wahnsinns wird von der Furcht vor dem Scharfsinn noch verschärft, der Furcht vor den Augenblicken der Wiederkehr, der Besinnung, wenn die Ahnung des Unheils derart beklemmend wäre, dass sie noch tieferen Wahnsinn heraufzubeschwören vermochte. Es gibt keine Rettung durch Demenz, weil es keinen Menschen gibt, der das Vorgefühl des Todes empfände, ohne sich vor dem etwaigen Einbruch der Luzidität zu fürchten. Du sehnst das Chaos herbei, vor seinen Lichtern schreckst du aber zurück.
Die Form des Wahnsinns wird von organischen und temperamentalen Bedingungen bestimmt. Da sich allerdings die Mehrheit der Irren aus Depressiven zusammensetzt, ist es fatal, dass die depressive Form häufiger bei den Wahnsinnigen als die Zustände angenehmer, ergötzlicher und übermäßiger Exaltation auftritt. Die schwarze Schwermut ist bei Geistesgestörten so verbreitet, dass fast alle zum Selbstmord neigen: einer, ehe man irre wird, äußerst heiklen Lösung.
Ich mochte unter einer einzigen Bedingung dem Wahnsinn verfallen: wenn ich nämlich wüsste, dass ich ein heiterer, lebhafter und beständig hochgemuter Irrer würde, der sich in keinerlei Grübeleien verspönne und den keine Obsession befiele, der allerdings vom Morgengrauen bis zum Einbruch der Nacht sinnlos lachte. Obwohl ich unbändig nach lichten Ekstasen lechze, bin ich selbst diesen abhold, folgen ihnen doch unweigerlich Depressionen. Ich begehre hingegen ein Bad glühenden Lichtes, das aus mir hervorbrechen und die gesamte Welt verklaren sollte, ein Bad, das frei von den Spannungen der Ekstase die Stille lichter Ewigkeit wahrte Weitab von der Konzentration der Verzückung, gleiche es der Schwerelosigkeit der Anmut und der Wärme des Lächelns. Die gesamte Welt schwebe in diesem Traum von Licht, in dieser lichtdurchfluteten und körperlosen Verzauberung. Hindernisse und Materie, Form und Grenzen zerrinnen – unter solchen Umstanden stürbe ich den Lichttod.
29-31

Vom Tode
Es gibt Probleme, welche dich, sobald sie gelost sind, dem Leben entreißen oder gar auflösen. Dringst du in sie ein, so ist nichts mehr zu verlieren oder zu gewinnen. In der Perspektive eines derartigen Gefildes werden das geistige Abenteuer und der unbestimmte Elan hin zu mannigfachen Lebensformen, der absurde und unumschränkte Trieb hin zu unzugänglichen Inhalten und die Unzufriedenheit bei der Abgrenzung empirischer Ebenen – zu bloßen Manifestationen einer überschwenglichen Empfindlichkeit, der jene unendliche Ernsthaftigkeit abgeht, welche den von Fahrnissen Heimgesuchten kennzeichnet. Unendlich ernst sein heißt, verloren sein. Hierbei geht es weder um den ruhigen Geist noch am die Gewichtigkeit sogenannter ernsthafter Menschen, sondern am eine derart irrsinnige Spannung, dass man jeden Augenblick auf die Ebene der Ewigkeit erhoben wird. In der Geschichte dahinzuleben hat alsdann überhaupt keine Bedeutung mehr, weil der Augenblick mit so viel überspitzter Anspannung erlebt wird, dass die Zeit angesichts der Ewigkeit blass und belanglos erscheint. Es versteht sich von selbst, dass im Hinblick auf rein formale Probleme, gleichgültig wie schwierig sie auch sein mögen, keine grenzenlose Ernsthaftigkeit gefordert werden darf, weil diese ausschließlich der Ungewissheit des Verstandes und nicht dem organischen und heilen Gefüge unseres Wesens entspringen. Nur der organische und existenzielle Denker ist zu dieser Ernsthaftigkeit fähig, weil nur ihm die Wahrheiten als Ausgeburten innerlicher Drangsal und organischen Gebrechens, keineswegs aus unnützer und überflüssiger Spekulation hervorgegangen, lebendig sind. Dem abstrakten Menschen, der nur aus Lust am Denken denkt, steht der organische Mensch gegenüber, der kraft eines vitalen Ungleichgewichts denkt und jenseits von Wissenschaft und Kunst weilt. Ich weide mich an dem Gedanken, dem ein Duft von Blut und Fleisch anhaftet, und ziehe einer leeren Abstraktion einen Gedankengang vor, der einer sexuellen Aufwallung oder einer nervlichen Depression entsprießt. Hat sich die Menschheit denn immer noch nicht davon überzeugt, dass die Zeit oberflächlicher und gescheiter Geschäfte vorbei ist, dass ein Aufschrei aus Verzweiflung unermesslich viel mehr offenbart als die spitzfindigste Unterscheidung und eine Träne stets tiefere Wurzeln hat als ein Lächeln? Warum wollen wir den Ausschließlichen Wert der lebendigen Werte, der aus uns hervorgewachsenen Wahrheiten nicht anerkennen, welche unbekannte Wirklichkeiten und grundlegende Werte enthüllen? Weshalb verstehen wir denn nicht, dass man lebendig über den Tod, über das gefährlichste der bestehenden Probleme, nachdenken kann und, wenn dessen Aufwerfung uns im Leben vereinsamt und auflöst, uns dessen ungeachtet durch innige und schmerzvolle Anteilnahme eine lebende Wahrheit geoffenbart wird?
Kann man überhaupt vom Tode reden, ohne von der Erfahrung der Agonie durchdrungen zu sein? Der Tod kann kaum begriffen werden, wenn das Leben nicht als langwieriger Todeskampf empfunden wird, in dem der Tod mit dem Leben verwachst. Der Tod ist nicht etwas Äußerliches, vom Leben ontologisch Verschiedenes, denn ein vom Leben unabhängiger Tod kann nicht statthaben. In den Tod eingehen bedeutet nicht, wie die gängige Weltanschauung und das Christentum im allgemeinen wähnen, seinen letzten Atemzug tun und in einen fremdartigen Daseinsbereich mit einer vom Leben verschiedenen Beschaffenheit und Positivität schreiten, sondern im Fortschreiten des Lebens einen Pfad zum Tode entdecken und in den Zuckungen des Lebendigen einer immanenten Vertiefung teilhaftig werden. Im Christentum und in den metaphysischen Lehren, welche die Unsterblichkeit anerkennen, ist das Eintreten ins Todesreich ein Triumph, ein Zugang zu anderen metaphysischen, vom Leben grundverschiedenen Bereichen. Durch den Tod, der sich in ein von der Natur gelöstes Reich verwandelt, wird der Mensch erlöst; die Agonie hingegen erschließt vollkommen transzendente Sphären, anstatt Ausblicke auf das Leben, in dem sie sich behauptet, zu eröffnen. Im Unterschied zu diesen Visionen scheint mir der wahre Sinn der Agonie in der Offenbarung der Immanenz des Todes im Leben zu bestehen. Weshalb verspüren nur wenige das Gefühl der Immanenz des Todes im Leben, und warum kommt die Erfahrung des Todeskampfes kaum vor? ist nicht etwa unsere gesamte Voraussetzung irrig, und wird der Entwurf einer Metaphysik des Todes nicht nur auf Grand der Vorstellung seiner Transzendenz glaubwürdig?
Die gesunden, normalen und mittelmäßigen Menschen haben keine Erfahrung der Agonie und auch sonst keinerlei Todesempfindung. Sie leben dahin, als hatte das Leben endgültigen Charakter. Es liegt in der Struktur des oberflächlichen Gleichgewichts normaler Menschen, die absolute Autonomie des Lebens vom Tode zu fühlen und diesen in einer dem Leben transzendenten Realität zu objektivieren. Deswegen wähnen sie, der Tod komme von außen, nicht aus weltinnerstem Verhängnis. Ohne Todesgefühl leben bedeutet, der trunkenen Bewusstlosigkeit des Gemeinen zu frönen, der sich gebärdet, als sei der Tod keine ewige und beunruhigende Gegenwart. Es ist eine der gewaltigsten Irrungen des Durchschnittsmenschen, an die Endgültigkeit des Lebens zu glauben und des Gefühls der Knechtschaft des Lebens im Tode ledig zu sein. Die Offenbarungen metaphysischer Ordnung beginnen erst, wenn das oberflächliche Gleichgewicht des Menschen ins Wanken gerät und die unbefangene Spontaneität durch eine schmerzliche und gespannte Bedrängnis der Lebenskraft ersetzt wird.
Die Transzendenz des Todes erscheint in den Visionen derjenigen, welche den Ungewissheiten des Lebens weder eine organische Grundlage noch innerliche Agonie entlocken, sondern eine äußere Ursache erschließen, die das Gefühl, vom Tode jählings und schleunig verschlungen zu werden, zum Paroxysmus steigert. Bei diesen ist das Todesgefühl derart selten, dass wir sein Vorhandensein in Zweifel ziehen können. Selbst wenn es eine gewaltige Intensität erreicht, verwirkt eine zeitlich dermaßen entlegene Erscheinung die Möglichkeit einer schmerzvollen Obsession. Der Umstand, dass die Empfindung des Todes sich nur entfaltet, wo die Lebenskraft eine Störung ihres Gleichgewichts oder eine Hemmung ihrer untergründigen Spontaneität erlitten hat, wenn das Leben in den Urtiefen erschüttert ist und der Rhythmus der Vitalität in einer vollkommenen Spannung und nicht in einer oberflächlichen und ephemeren Expansion wirkt, beweist die Immanenz des Todes im Leben mit innerer Gewissheit. Die Betrachtung seiner Abgründe zeigt uns, wie trügerisch doch der Glaube an die Lauterkeit des Lebens und wie begründet die Oberzeugung von einem metaphysischen Hintergrund der Dämonie alles Lebens ist.
Doch wenn der Tod dem Leben innewohnt, warum macht uns das Todesbewusstsein lebensunfähig? Beim normalen Menschen wird das Leben nicht getrübt, weil der Vorgang des Eingehens in den Tod gänzlich naiv, durch die Verminderung der Intensität des Lebens erfolgt. Für ihn gibt es nur den allerletzten Todeskampf, keine andauernde, an die Voraussetzungen des Lebendigen gebundene Agonie. Jeder Schritt im Leben ist – aus tiefergehender Perspektive betrachtet – ein Schritt zum Tode, die Erinnerung aber nur ein Wink des Nichts. Der normale, metaphysischen Verständnisses ermangelnde Mensch hat kein Bewusstsein vom allmählichen Einsinken in den Tod, obgleich auch er wie jedes Lebewesen diesem unerbittlichen Los nicht entschlüpft. Wo sich das Bewusstsein der Abhängigkeit vom Leben entzogen hat, wird die Offenbarung des Todes so mächtig, dass ihre Gegenwart alle Naivität, allen Freudentaumel und jede natürliche Wonne zerschlagt. Im Todesbewusstsein liegt etwas Perverses und unendlich Verkommenes. Die ganze naive Poesie des Lebens, alle seine Verlockungen und Reize erscheinen inhaltsleer, so wie auch alle finalistischen Entwürfe und theologischen Verheißungen hohl wirken.
Einen lange währenden Todeskampf bewusst ertragen bedeutet, die individuelle Erfahrung aus dem naiven Rahmen und ihrer natürlichen Unversehrtheit herauslösen, um ihre Nichtigkeit und Belanglosigkeit zu entlarven; heißt, selbst die untergründigsten Wurzeln des Lebens zerfressen. Sehen, wie sich der Tod über die Welt ausbreitet, wie er einen Baum entwurzelt und sich in den Traum einschleicht, wie er eine Blute oder eine Zivilisation mit Welkheit anhaucht, wie er am Einzelnen und an der Kultur als immanenter zernichtender Odem nagt, ist jenseits der Möglichkeit von Tranen und Reue, jenseits jedweder Kategorie oder Form. Wer das Gefühl jener schauerlichen Agonie nicht durchlebt hat, wenn sich der Tod in dir emporhebt und dich wie ein Blutandrang, wie eine unbezwingliche und erstickende innerliche Gestalt umgreift oder wie eine Schlange umschlingt und dir Schreckensgespinste einjagt – der kennt den teuflischen Charakter des Lebens und die inneren Aufwallungen nicht, welchen hehre Verklärungen entsprießen. Es ist ein schwarzer Rausch vonnöten, um zu begreifen, weshalb du den Untergang einer solchen Welt herbeisehnst. Nicht lichte Trunkenheit der Verzückung, wenn dich paradiesische Visionen in den Bann von Gleiß und Herrlichkeit schlagen und wenn da dich in ein Reich der Lauterkeit aufschwingst, darin sich das Leben zum Immateriellen verflüchtigt, sondern eine tolle, gefährliche und verderbliche Folterqual des Lebens ist das Wesen des düsteren Rausches, aus dem der Tod als furchtbare Anfechtung der im Nachtmahr aufglühenden Schlangenaugen hervorleuchtet.Solche Empfindungen und Bilder erfahren bedeutet indessen, dem Wesen der Wirklichkeit so innig verbunden sein, dass Leben und Tod ihren Trug entlarven, um sich in dir in wesenhaftester und dramatischster Gestalt zu entfalten. Ein exaltierter Todeskampf fügt in rasendem, schrecklichem Strudel Leben und Tod in sich zusammen, und ein bestialischer Satanismus entlockt der Wonne Tranen. Das Leben als lange Agonie und als Pfad zum Tode ist lediglich eine andere Formulierung der dämonischen Dialektik des Lebens, der zufolge es Gestalten gebiert, um sie in irrationalem und immanentem Schaffensdrang zu zertrümmern. Die Mannigfaltigkeit der Lebensformen wird nicht von transvitaler Konvergenz oder transzendenter Intentionalität umfasst, sondern erwachst aus einem wilden Rhythmus, in dem du nichts als die Dämonik des Werdens und Vergehens erblickst. Die Untergründigkeit des Lebens zerstiebt in einem überschwenglichen Ausbruch von Gestalten und Inhalten, wegen des tobenden Dranges, verbrauchte Aspekte durch neue zu ersetzen, ohne dass diese Substitution einen nennenswerten Überschuss oder qualitativen Zuwachs bedeutete. Die Menschen würden eine relative Glückseligkeit empfinden, wenn sie sich diesem Werden hingaben und jenseits aller beklemmenden Drangsal versuchten, alle vom Augenblick dargebotenen Möglichkeiten aufzusaugen, ohne beständige Vergleichung, die in jedem Moment eine unüberwindliche Relativität entdeckt. Die Erfahrung der Naivität ist der einzige Weg zum Heil. Aber für jene, welche das Leben als langwierigen Todeskampf empfinden und entwerfen, schrumpft die Heilserwartung zum simplen Problem zusammen. Auf diese Weise gibt es keine Erlösung.
Die Offenbarung der Immanenz des Todes im Leben findet im allgemeinen in der Krankheit und in den depressiven Zuständen statt. Gewiss gibt es auch andere Wege, sie sind jedoch gänzlich zufällig und individuell, so dass ihnen kein dem Siechtum oder den Depressionen vergleichbares Offenbarungsvermögen zukommt.
Sollten die Krankheiten überhaupt eine philosophische Sendung auf Erden haben, so kann es nur diejenige sein aufzuzeigen, wie trüglich das Gefühl der Ewigkeit des Lebens und wie zerbrechlich die Illusion seiner endgültigen Beendigung oder Erfüllung ist. Denn im Siechtum ist der Tod immerdar im Leben gegenwärtig. Krankhafte Zustände binden uns an metaphysische Wirklichkeiten, welche der normale und gesunde Mensch niemals verstehen wird. Offenkundig gibt es bei den Krankheiten eine Hierarchie hinsichtlich ihrer Offenbarungskraft. Nicht alle bieten die Erfahrung der Immanenz des Todes im Leben mit gleicher Dauer und Intensität, und nicht alle werden in identischen Formen der Agonie sichtbar. Wie sehr sich die Krankheiten im Einzelnen auch individualisieren und spezifizieren mögen, es gibt trotzdem Sterbensweisen, welche von der Beschaffenheit der Krankheit als solcher abhängen. Die gesamte Vielfalt krankhafter Zustände legt eine Bedrückung des Lebendigen und eine Zersetzung seiner natürlichen Funktionen bloß. Das Leben ist so beschaffen, dass es seine Potentialitäten nur verwirklichen kann, indem es sich verhält, als stelle der Tod keine unabwendbare Gegenwart dar. Aus diesem Grunde wird der Tod in den normalen Offenbarungszuständen als von außen kommend und außerhalb des Lebens befindlich betrachtet. Das gleiche Gefühl bemächtigt sich auch der Jünglinge, wenn sie vom Tode reden. Doch wenn die Krankheit sie mit voller Wucht getroffen hat, verschwinden alle Illusionen und verstummen alle Verlockungen der Jugend. Es ist gewiss, dass hienieden die einzigen wahren und echten Gefühle der Krankheit entquellen. Alle anderen tragen fatalerweise ein gelehrtenhaftes Gepräge, weil aus einem organischen Gleichgewicht nur erdichtete Zustände aufkommen können, deren Komplexität eher das Ergebnis überreizter Einbildungskraft als einer wahren Aufwallung ist. Nur die wirklich Leidmütigen sind zu echten Inhalten und einer schrankenlosen Ernsthaftigkeit fähig. Die übrigen sind zur Anmut, zur Harmonie, zur Liebe und zum Tanz geboren. – Wie viele würden im Grunde ihres Wesens nicht auf metaphysische Offenbarungen aus Verzweiflung, Agonie und Tod zugunsten einer treuherzigen Liebe oder wollüstiger Gedankenlosigkeit beim Tanzen verzichten?
Und wie viele würden nicht einen aus Leiden erwachsenen Ruhm für ein anonymes und unbeschwertes Dasein aufgeben?
Jede Krankheit ist Heldentum; aber Heldentum des Widerstands, nicht der Eroberung. Im Kranksein drückt sich der Heroismus durch den Widerstand angesichts der verlorenen Stellungen des Lebens aus. Diese Stellungen sind nicht nur für die von bestimmten Krankheiten organisch Getroffenen unwiederbringlich verloren, sondern auch für jene, bei denen depressive Zustände so häufig vorkommen, dass sie angesichts ihrer subjektiven Struktur einen konstitutionellen Charakter wahren. Die Depressionen offenbaren nicht nur das Dasein als fühlbare Objektivität, sondern auch den Tod. Also wird denn auch begreiflich, warum die Deutungen der bei gewissen Depressiven auftretenden Todesangst nicht tiefgründiger Rechtfertigungen vorzubringen vermögen. Wie ist es möglich, das bei einer großen, bisweilen gar überschwänglichen Lebenskraft die Todesfurcht oder wenigstens das Problem des Todes überhaupt hervortritt? Dieser die geläufige Mentalität kennzeichnenden Verwunderung kann man nur eine der gewaltigen Möglichkeiten wesentlichen Verständnisses entgegenstellen, die im Innern der depressiven Zustände eingeschlossen sind. Denn in diesen Zuständen, in welchen die klaffende Entzweiung mit der Welt schmerzhaft wird und am sich greift, nähert sich der Mensch zunehmend seinen innerlichen Wirklichkeiten und deckt den Tod in der ureigenen Subjektivität auf. Ein Vorgang der Verinnerlichung dringt bis zum Wesenskern der Subjektivität vor und geht über sämtliche sozialen Faktoren, welche sie verkleiden, hinaus. Wird auch dieser Urkern überwunden, dann stoßt die fortschreitende paroxystische Verinnerlichung in eine Gegend vor, wo das Leben mit dem Tode verwoben ist, wo sich der Mensch nicht durch Individuation des Seinsgrundes entschlagen hat und wo der tolle, dämonische Rhythmus der Welt in seiner vollkommenen Urgründigkeit tobt.
Die Empfindung der Immanenz des Todes im Leben übersteigert die Depression des von ihr Befallenen und ruft eine Stimmung unausgesetzter Unzufriedenheit und Unruhe hervor, welche niemals Gleichgewicht und Frieden finden werden.
Vermittels der Empfindung der Gegenwart des Todes im Lebensgefüge schleicht sich ein Hauch des Nichts ins Seiende. Man kann sich das Leben nicht ohne den Tod vorstellen, mithin auch kein Leben ohne ein Prinzip absoluter Negativität. Dass das Nichts in der Idee des Todes einbegriffen ist, beweist die Furcht vor dem Tod, welche nur die Angst vor dem Nichts darstellt, in das uns der Tod stürzt. Die Immanenz des Todes im Leben ist ein Vorzeichen des endgültigen Triumphs des Nichts über das Leben, wodurch bewiesen wird, dass die Gegenwart des Todes keinen anderen Sinn hat, als den zum Nichts hinführenden Weg zu vergegenwärtigen.
Losung und Ausgang der ungeheuren Tragödie des Lebens und insonderheit des Menschen werden zeigen, wie trügerisch der Glaube an die Ewigkeit des Lebens ist und dass gleichwohl die einzige Befriedung des geschichtlichen Menschen im naiven Gefühl der Ewigkeit dieses Lebens besteht.
Im Grunde gibt es nur Furcht vor dem Tode. Was wir die Vielgestaltigkeit der Ängste nennen, ist nichts anderes als eine Manifestation mit verschiedenen Aspekten gegenüber derselben grundlegenden Wirklichkeit. Die individuellen Ängste sind allesamt durch verborgene Entsprechungen an die wesentliche Todesangst gebunden. Jene, die sich der Todesangst auf Grund künstlicher Gedankengange zu entledigen trachten, irren gewaltig, weil es absolut unmöglich ist, eine organische Angst durch abstrakte Gedankenkonstruktionen zu entschärfen. Wer das Todesproblem ernstlich aufwirft, kann unmöglich nicht von Angst zerfressen sein. Selbst die an die Ewigkeit Glaubenden verführt die Todesfurcht zu ihrem Glauben. Im Ewigkeitsglauben wurzelt die schmerzvolle Anstrengung des Menschen, auch ohne absolute Gewissheit die Welt der Werte, inmitten welcher er gelebt und zu denen er beigetragen hat, zu erretten, das Nichts im Zeitlichen zu bezwingen und das Universale im Ewigen zu begründen. Im Angesichte des Todes, der ohne religiöse Zuversicht hingenommen wird, besteht nichts, was die Menschheit für die Ewigkeit geschaffen wähnt. Die gesamte Welt der Formen und abstrakten Kategorien erweist sich angesichts des Todes als gänzlich irrelevant, und der Universalitätsanspruch des Formalen und Kategorialen verkümmert angesichts der unwiderruflichen Nichtswerdung durch den Tod zum bloßen Phantasma. Denn niemals wird eine Form oder Kategorie das Dasein in seiner wesentlichen Struktur erfassen, wie sie auch niemals die innersten Grunde des Lebens und des Todes erschließen wird. Was kann der Idealismus oder der Rationalismus diesen gegenüberstellen? Nichts. Alle anderen Vorstellungen und Doktrinen lehren aber beinahe nichts über den Tod. Die allein gültige Haltung wäre absolutes Schweigen oder ein verzweifelter Aufschrei.
Jene, die behaupten, dass die Furcht vor dem Tode einer tiefgründigen Rechtfertigung entbehre, weil es, solange ein Ich vorhanden ist, keinen Tod gibt und, wenn man stirbt, dieses Ich sich verflüchtigt, vergessen den eigentümlichen Vorgang allmählicher Agonie.
Welche Linderung kann die künstliche Trennung zwischen Ich und Tod einem spenden, der vom überwältigenden Gefühl des Todes aufgewühlt wird? Welchen Sinn kann spitzfindige Tüftelei oder logische Argumentation für jemanden haben, welcher von der Empfindung des Irreparablen tief durchdrungen ist? Alle Versuche, die Probleme des Daseins auf eine logische Ebene umzusetzen, sind nichtig. Die Philosophen sind viel zu dunkelhaft, am ihre Todesfurcht zu gestehen, und allzu anmaßend, um die geistige Fruchtbarkeit der Krankheit anzuerkennen. In ihren Betrachtungen über den Tod liegt vorgegaukelte Heiterkeit: in Wirklichkeit zittern und beben sie mehr als alle andern. Man darf jedoch nicht vergessen, dass die Philosophie die Kunst ist, Gefühle und innere Qualen zu maskieren, am die Welt über die wahren Wurzeln des Philosophierens zu tauschen.
Das Gefühl des Irreparablen und Unheilbaren, welches das Bewusstsein und die Empfindung des Todeskampfes stets begleitet, kann bestenfalls ein schmerzendes, mit Furcht vermischtes Erdulden erklären, auf gar keinen Fall jedoch die Liebe oder die Sympathie für den Tod. Die Kunst des Sterbens lasst sich nicht erlernen, weil sie weder Techniken noch Regeln oder Normen aufweist. Die Unheilbarkeit der Agonie wird im ureigenen Wesen des Einzelnen mit unendlichen Schmerzen und Spannungen erlitten. Der Mehrheit der Menschen fehlt das Bewusstsein der langsamen Agonie in ihrem Innern. Sie kennen nur die Agonie, welche dem endgültigen Eingehen ins Nichts vorausgeht. In ihrem Bewusstsein gewahren allein die Augenblicke dieser Agonie wichtige Offenbarungen des Daseins, weshalb sie alles vom Ende erwarten, anstatt der Bedeutung eines langsamen und offenbarungsschwangeren Todeskampfes inne zu werden. Das Ende indessen wird ihnen viel zuwenig enthüllen, und also werden sie so unbewusst verloschen, wie sie gelebt haben.
Dass sich die Agonie zeitlich entfaltet, beweist, dass die Zeitlichkeit nicht nur ein Wesenszug oder eine Bedingung der Schöpfung, sondern auch des Todes, des dramatischen Sterbevorgangs ist. Hier manifestiert sich der dämonische Charakter der Zeit, in der Geburt und Tod, Schöpfung und Zerstörung verlaufen, ohne dass in diesem Gefüge eine Konvergenz zu irgendeiner transzendenten Ebene emporragte.
Nur in der Dämonie der Zeit ist das Gefühl des Unheilbaren möglich, das sich uns als unabwendbare Notwendigkeit entgegen allen unseren intimsten Strebungen aufdrängt. Vollkommen überzeugt sein, einem bitteren Los, welches du anders dir wünschtest, nicht entrinnen zu können, wissen, dass du einer unbeugsamen Fatalität unterworfen bist und dass die u. dramatischen Zerstörungsprozess nur noch vergegenwärtigen wird: das sind Ausdrucksformen des Unheilbaren und der Agonie. ist denn das Nichts keine Rettung? Doch wie kann die Rettung im Nichts erfolgen?
Wenn die Rettung im Dasein beinahe unmöglich ist, wie sollte sie in der absoluten Abwesenheit jeglicher Existenz denkbar sein? Da es weder im Nichts noch im Sein Heil gibt: Es zerfalle diese Welt mitsamt ihren ewigen Gesetzen zu Staub und Asche!
32-40

Die Melancholie
Jeder Gemütszustand neigt dazu, sich einem ihm entsprechenden Äußeren anzupassen oder dieses Äußere in eine seinem Wesen gemäße Erscheinung zu verwandeln. Denn es gibt eine innige Entsprechung zwischen allen erhabenen und tiefen Zuständen, zwischen der subjektiven und objektiven Ebene. Es wäre absurd, sich einen überquellenden Enthusiasmus in einer seichten und geschlossenen Umwelt vorzustellen; sollte dies dennoch vorkommen, dann wäre es auf eine übermassige Fülle zurückzuführen, welche die gesamte Umgebung subjektiveren wurde. Die Augen des Menschen sehen in der Außenwelt, was ihn im Innersten durchwühlt. Der äußere Rahmen ist zumeist das Ergebnis einer subjektiven Projektion, in Ermangelung welcher die Seelenzustände und die heftigen Erfahrungen nicht vollkommen zur Geltung kommen können. Die Verzückung ist niemals lediglich innere Verzehrung, vielmehr setzt sie einen innerlichen Lichtrausch in die Außenwelt um. Es genügt, das Antlitz eines Verzückten zu betrachten, am alles zu bemerken, was seine geistige Spannung erschaut und erträumt. Die Intentionalität der inneren Zustände erklärt sowohl die Harmonie zwischen den verschiedenen Ebenen als auch die Notwendigkeit, mit der sie einander bedingen, weil sie auf die Unmöglichkeit dieser Zustände, überhaupt ungetrübt zu bleiben, hinweist.
Warum fordert die Melancholie eine unendliche Außenwelt? Weil ihr eine Ausdehnung und eine Leere innewohnen, die sich allen Grenzen entziehen Die Grenzenüberschreitungen können positiv oder negativ erfolgen. Überschwang, Begeisterung, Wat sind überströmende Zustände, deren Heftigkeit jede Beschränkung sprengt und die über das normale Gleichgewicht hinauswachsen. Es ist ein positiver Aufschwung des Lebens, der einem Übermaß an Vitalität und einem organischen Überschäumen entließt. In den positiven Zuständen geht das Leben über seine normalen Bestimmungen hinaus, jedoch nicht um sie zu verneinen, sondern am die schwelenden Reserven zu entfesseln, denn mit deren Akkumulation würde ein heftiger Ausbruch drohen. Alle extremen Zustände sind Derivate des Lebens, vermittels welcher es sich vor sich selbst schützt. In den negativen Zuständen hat die Transzendierung der Grenzen einen gänzlich verschiedenen Sinn, weil sie nicht von der Überfülle ausgeht, sondern von einem grenzenlosen Abgrund; umso mehr als dieser Abgrund im Wesen zu wurzeln scheint, nach und nach wie ein Gangrän wuchernd. Es ist ein Vorgang des Schrumpfens, nicht des Wachstums: aus diesem Grunde ist er eine Rückkunft zum Nichts und nicht ein Gedeihen im Sein.
Das Gefühl der Leere und der Erweiterung zum Nichts, welches der Melancholie nicht mangelt, hat seine tiefere Wurzel in der Müdigkeit, die allen negativen Zuständen zugrunde liegt.
Die Übermüdung trennt den Menschen von der Welt und von den Dingen. Der heftige Rhythmus des Lebens schwächt, die organischen Zuckungen mitsamt der inneren Aktivität lockern jede Spannung, welche das Leben in der Welt differenziert, es als immanentes Moment des Daseins begründet. Die Erschöpfung ist die primäre organische Determinante der Erkenntnis, weil sie die unentbehrlichen Bedingungen einer Differenzierung des Menschen in der Welt entwickelt; durch sie gelangt er zu jener Perspektive, welche die Welt ihm entgegenstellt. Das Erschöpft sein zwingt dich, unter dem Niveau des Lebens zu vegetieren, und von den gewaltigen vitalen Spannungen lasst es nur Ahnungen zu. Der Born der Melancholie entspringt also einem Bereich, wo das Leben unsicher und fragwürdig ist. Also wird die Fruchtbarkeit der Erschöpfung für die Erkenntnis und ihre Sterilität fürs Leben erklärlich.
Wenn in den gemeinen und gewöhnlichen Erlebnissen die naive Intimität in Bezug auf die individuellen Aspekte des Daseins zahlt, so führt die Trennung von ihnen in der Melancholie zu einem vagen Gefühl gegenüber der Welt und einer Empfindung von deren Verschwommenheit. Eine innige Erfahrung und eine befremdliche Vision losen alle festen Formen dieser Welt auf, zerschlagen ihre individualisierten und differenzierten Gerüste, um ihr ein Gewand immaterieller und universaler Transparenz anzulegen. Die allmähliche Abkehr von allem Individuellen und Konkreten hebt dich zu einer vollkommenen Schau empor, die umso mehr an konkreter Wirklichkeit einbüßt, je weiter sie sich erstreckt. Es ist kein melancholischer Zustand ohne die erwähnte Erhöhung denkbar, ohne einen Aufflug zu den Höhen, ohne eine Übersteigung dieser Welt. Aber nicht jenes Übersteigen, welches aus Überheblichkeit oder Verachtung, aus Verzweiflung oder einer Neigung zu unendlicher Negativität hervorwachst, sondern aus einer anhaltenden Reflexion und einer diffusen, der Müdigkeit entsprungenen Träumerei. Dem Menschen wachsen in der Schwermut Schwingen, jedoch nicht um sich der Welt zu erfreuen, sondern um einsam zu sein. Welchen Sinn hat die Einsamkeit in der Melancholie? ist sie denn nicht an das Gefühl innerer und äußerer Unendlichkeit gebunden? Der melancholische Blick ist ausdrucksleer und entwirft keine Perspektive der Unbegrenztheit. Innerliche Uferlosigkeit und Verschwommenheit, die man nicht mit der Fruchtbarkeit der Liebe gleichsetzen darf, erfordern eine Weite, deren Umfang unfasslich ist. Die Melancholie stellt mithin einen vagen Zustand dar, welcher nichts Bestimmtes oder Deutliches beabsichtigt. Die gemeinen Erlebnisse suchen nach tastbaren und handfesten Gestalten. Die Berührung mit dem Leben erfolgt in diesem Falle durch das Individuelle; es ist eine enge und sichere Fühlung.
Die Abwendung vom Dasein als einer konkreten und qualitativen Gegebenheit und die Hingabe an die Grenzenlosigkeit erheben den Menschen über seine natürliche Ordnung. Die Perspektive der Unendlichkeit lasst ihn einsam und verlassen in der Welt erscheinen. Das Gefühl der eigenen Endlichkeit ist umso nachdrücklicher, je scharfer das Bewusstsein der Unendlichkeit der Welt. Wenn dieses Bewusstsein in einigen Zuständen auch deprimiert und geschunden ist in der Melancholie schmerzte sie weniger in Folge einer Sublimation welche Einsamkeit und Verlorensein weniger bedrückend wirken lasst indem sie ihnen zuweilen ein wollüstiges Wesen verleiht.
Das Missverhältnis zwischen der Unendlichkeit der Welt und der Endlichkeit des Menschen ist ein ernster Grund zur Verzweiflung; betrachtet man es indessen aus einer traumhaften Perspektive, wie sie in den melancholischen Zuständen vorkommt, so hört es auf, marternd zu sein, und die Welt erglänzt in unheimlicher und krankhafter Schönheit. Der riefe Sinn der Einsamkeit zielt auf eine schmerzhafte Heraushebung des Menschen aus dem Leben und eine Erregung in der Abgeschiedenheit beim Denken an den Tod. Einsam leben bedeutet, vom Leben nichts mehr fordern und nichts mehr erwarten. Die einzige Überraschung der Einsamkeit ist der Tod Die großen Einsamen haben sich niemals zurückgezogen, um sich auf das Leben vorzubereiten, sondern um verinnerlicht und resigniert die Auflösung ihres Lebens zu ertragen. Aus der Ödnis oder aus den Hohlen kann man keine Botschaft fürs Leben empfangen. Verdammt das Leben denn nicht alle aus Wüsteneien hervorgekrochenen Religionen? Und sind die Erleuchtungen und Verklärungen der hehren Einsamen nicht eher von einer apokalyptischen Endzeiterwartung und Weltuntergangsvision durchstrahlt als von einem funkelnden und triumphalen Nimbus umglänzt?
Die Einsamkeit der Melancholiker hat eine seichtere Bedeutung: sie hat mitunter ästhetischen Charakter. Redet man nicht von süßer, wollüstiger Melancholie? ist aber nicht auch die melancholische Haltung selbst auf Grund ihrer Passivität und perspektivischen Betrachtung ästhetisch verfärbt?
Die ästhetische Haltung angesichts des Lebens ist von einer beschaulichen Passivität gekennzeichnet, die allem, was der Subjektivität frommt, ohne Normen und Kriterien front. Die Welt wird als Schauspiel betrachtet und der Mensch als Zuschauer, der dem Verlauf gewisser Aspekte passiv beiwohnt. Die spektakuläre Lebensanschauung stoßt das Tragische und die dem Dasein immanenten Antinomien aus, welche dich, hast du sie einmal erkannt und gespurt, wie ein atemberaubender Wirbel ins Weltdrama hineinschleudern. Die Erfahrung des Tragischen setzt eine derartige Spannung voraus, dass sie das ästhetische Erlebnis kaum erahnen kann. Im Tragischen ist die inbrünstige Anteilnahme am Inhalt unseres Wesens so entscheidend, dass jeder Augenblick vom Schicksal, bei der ästhetischen Haltung hingegen vom Eindruck abhängt. Das Tragische schließt die Träumerei, die bei keinem ästhetischen Zustand ausbleibt, nicht als Grundelement ein. Das Ästhetische an der Melancholie manifestiert sich in der Neigung zu Passivität, Träumerei und sinnlicher Ergötzung. Das die Schwermut kaum einem einzelnen ästhetischen Zustand völlig gleichzusetzen ist, rührt von ihren vielgestaltigen Aspekten her. Kommt schwarze Schwermut denn nicht häufig genug vor? Doch was bedeutet zunächst süße Melancholie? Wer kennt nicht das Gefühl seltsamer Lust an manchen Sommernachmittagen, wenn man den Sinnen ohne gezielte Gedanken ausgeliefert ist und die Ahnung lichter Ewigkeit die Seele mit sonderbarer Ruhe durchtränkt? Es ist, als ob alle Sorgen dieser Welt und alle geistigen Ungewissheiten vor einem Schauspiel von berückender Schönheit verstummten, angesichts dessen Verlockung jedes Problem überflüssig würde. Jenseits aller Erregtheit, aller Betrübnis und Aufwallung saugt ein ruhiges Erleben die gesamte Pracht der Umgebung mit verhaltener Wollust auf. Die Gelassenheit ist eine wesentliche Eigenart melancholischer Zustände: es ist die Abwesenheit besonderer Regungen. Auch die Reue, die zur Struktur der Melancholie gehört, erklärt die Abwesenheit besonderer Intensität bei dieser. Selbst wenn die Reue beharrlich wäre, konnte sie doch niemals bohrend genug sein, am tiefen Schmerz auszulosen. Die Vergegenwärtigung gewisser Motive oder Begebnisse aus der Vergangenheit, die Ansammlung einiger wirkungslos gewordener Elemente in unserer Affektivität, das Verhältnis zwischen gefühlsbetonten Empfindungen und der Umwelt, in der sie entstanden sind, welche sie jedoch verlassen haben – sind Wesensbestimmungen der Melancholie Die Reue ist Gefühlsausbruch eines abgründigen Vorganges: des Zugehens auf den Tod durch das Leben. Ich bereue etwas, was in mir erstorben und von mir abgestorben ist. Ich vergegenwärtige nur das Gespenst mancher Wirklichkeit und mancher vergangenen Erfahrung. Aber dies genügt, am uns zu zeigen, wieviel von uns abgestorben ist. Die Reue offenbart die dämonische Bedeutung der Zeit, welche, indem sie das Wachstum in uns bewirkt, untergründig bereits die Auflösung anbahnt.
Bedauern und Reue stimmen den Menschen melancholisch, ohne ihn zu lahmen oder sein Streben und Trachten zu vereiteln, weil in ihnen nur das Bewusstsein des Irreparablen in Bezug auf die Vergangenheit wirkt, während die Zukunft gewissermaßen offenbleibt. Die Melancholie ist kein Zustand konzentrierten, undurchdringlichen Ernstes, der sich aus einer organischen Erkrankung entwickelt, denn in ihr ist nichts von jenem bestürzenden Gefühl des Irreparablen im Hinblick auf den gesamten Verlauf des Daseins zu spüren das in gewissen Fällen tiefen Grams nicht ausbleibt. Selbst jene schwarze Schwermut ist eher vorübergehende Stimmung als konstitutionelle Veranlagung. Und sogar im letzteren Fall ist sie auf Grund ihres Traumcharakters einer Krankheit mit allen ihren Auswirkungen gleichzusetzen Formal genommen gibt es sowohl bei der süßen und wollüstigen als auch bei der schwarzen Schwermut die gleichen Wesenheiten: innerliche Leere äußere Unendlichkeit, Verschwommenheit des Empfindens, Träumerei, Sublimierung – nur vom Standpunkt der gefühlsbetonten Betrachtungsweise wird die Differenzierung sinnfällig. Es wäre denkbar, das die Multi Polarität der Melancholie mehr von der Struktur als vom Wesen der Subjektivität abhängt. In diesem Fall wurde der melancholische Zustand mit seinem diffusen träumerischen und verschwommenen Charakter in jeder Person spezifische Gestalt annehmen. Weil es kein Zustand von dramatischer Intensität ist, schwingt und schwankt er mehr als alle anderen. Und da er mehr poetische als aktive Vorzüge besitzt, hat er etwas von jener unauffälligen Anmut, welche wir deshalb eher bei Frauen antreffen, jedoch niemals in tiefer und verzehrender Trauer.
Dieser Anmut begegnet man auch in den Landschaften melancholischen Kolorits. Die ausgedehnte Perspektive der niederländischen oder der Landschaftsmalerei der Renaissance mit Ewigkeiten von Licht und Schatten, mit Tälern, deren Schlängeln die Unendlichkeit symbolisiert, und mit Lichtstrahlen, welche der Welt Immaterialität verleihen, mit den Sehnsüchten und den Klagen der Menschen, welche ein Lächeln aus Weisheit oder Wohlwollen kaum andeuten – diese gesamte Perspektive bringt eine melancholische und schwerelose Grazie ans Licht. In einem derartigen Rahmen scheint der Mensch mit Bedauern und Resignation auszurufen: »Was wollt ihr, wenns nicht mehr gibt!« Am Ende jeder Melancholie eröffnet sich die Möglichkeit des Trostes oder der Resignation. Ihre ästhetischen Elemente bergen die Keime künftiger Harmonie in sich, wie sie im tiefen und organischen Gram nie vorkommen. Aus diesem Grunde führt eine Phänomenologie der Traurigkeit zum Irreparablen, die der Melancholie jedoch zu Traum und Anmut.
41-46
Alles ist nichtig!
Welche Bedeutung mag der Tatsache zukommen, dass ich mich aufrege, dass ich leide oder denke? Meine Gegenwart in der Welt wird – zu meinem tiefen Bedauern – das ruhige Dasein einiger und – zu meinem noch tieferen Bedauern – die bewusstlose und behagliche Unbefangenheit anderer erschüttern. Obwohl ich fühle, dass meine Tragödie die größte der Geschichte ist, großer als der Sturz von Kaisern oder irgendein Massenunfall in der Tiefe eines Schachtes – habe ich gleichwohl das verborgene Gefühl meiner vollkommenen Nichtigkeit und Bedeutungslosigkeit. Ich bin überzeugt, ein absolutes Nichts im All zu sein, aber fühle, dass mein Dasein das einzig wirkliche ist. Und wenn ich zwischen dem Sein der Welt und meinem eigenen Dasein zu wählen hatte, würde ich jenes mitsamt seinen Gestirnen und Gesetzen beseitigen und mich erkühnen, allein durchs absolute Nichts zu schweben. Obgleich mir das Leben eine Folterpein ist, kann ich nicht darauf verzichten, weil ich nicht an die Absolutheit der Werte jenseits des Lebens glaube, in deren Namen ich mich aufopfern müsste. Um ehrlich zu sein, müsste ich sagen, dass ich weder weiß, warum ich lebe, noch weshalb ich nicht zu leben aufhöre. Wahrscheinlich ist der Schlüssel in der wüsten und wütenden Urgewalt des Lebens zu finden, welche das Leben grundlos aufrechterhält. Und wenn es nur absurde Gründe zu leben gäbe? Aber waren diese noch als Gründe zu bezeichnen? Diese Welt verdient es nicht, dass man sich für irgendeine Idee oder irgendeinen Glauben aufopfere. Sind wir denn heute glücklicher, weil sich andere für unser Wohl und unsere Aufklärung aufgeopfert haben? Um welchen Wohls und welcher Aufklärung willen? Wenn sich jemand aufgeopfert hatte, auf dass ich jetzt glücklich sei, dann wäre ich noch unglücklicher als er, weil ich nicht einsehe, weshalb ich meine Existenz auf einem Leichenacker errichten sollte. In manchen Augenblicken fühle ich mich für das ganze Elend der Geschichte verantwortlich und verstehe nicht, warum einige unseretwillen ihr Blut vergossen haben. Die größte Ironie wäre jedoch, wenn sich feststellen ließe, dass jene glücklicher als wir gewesen sind. Mich musste nichts mehr in dieser Welt interessieren; selbst das Problem des Todes müsste mir lächerlich erscheinen, der Schmerz beschrankt und nichtssagend, die Begeisterung unrein, das Leben rational, die Dialektik des Lebens logisch und nicht teuflisch, die Verzweiflung geringfügig und einseitig, die Ewigkeit ein leeres Wort, das Fatum eine Posse … Denn ich überlege ernstlich, welcher Sinn dem allen wohl zugrunde liegen mag? Weshalb noch Probleme aufstellen, Lichter auswerfen oder Schatten eintragen? Ware es nicht besser, in vollkommener Einsamkeit meine Tränen im Meeressande zu vergraben? Ich habe indessen nie geweint, weil sich meine Tränen in Gedanken verwandelten. Und sind diese Gedanken nicht bitter wie Zähren?
47-48
Verzückung
Ich weiß nicht, welchen Sinn die Gegenwart der gewaltigsten, offenbarungsträchtigsten und üppigsten, vielschichtigsten und gefahrenbeladensten Ekstase, der Verzückung des Daseinsurgrundes, in einem skeptischen Geiste haben mag, dem diese Welt eine Welt von Unlösbarkeiten ist. In der Ekstase erwirbt man keinerlei deutliche Gewissheit oder bestimmte Erkenntnis, das Gefühl einer wesentlichen Anteilnahme ist indessen derart intensiv, dass es alle Grenzen und Kategorien sprengt. Es ist, als ob sich in dieser Welt der Hindernisse, des Elends und der Qualen, durch welche uns die individuellen Aspekte des Daseins in ihrer unauflöslichen Konsistenz treffen, sich ein Tor zum inneren Kern des Daseins öffnete, den wir in der einfachsten und wesentlichsten Vision, in der herrlichsten metaphysischen Entzückung erhaschen. Die Oberflachenschicht der Existenz und die individuellen Formen scheinen dahinzuschmelzen, am das Emportauchen der tiefsten Bereiche zu fordern. Und ich frage mich, ob das wahre metaphysische Gefühl des Daseins ohne die Beseitigung der Oberflachenschichten und der individuellen Formen überhaupt möglich sei. Denn nur durch eine Läuterung der Existenz von ihren unwesentlichen und kontingenten Elementen kann man zum Wesen vordringen. Das metaphysische Gefühl des Daseins ist ekstatischer Natur, und jede Metaphysik wurzelt in einer besonderen Form der Verzückung. Irrtümlicherweise erkennt man nur die religiöse Ausprägung der Ekstase an. Dabei gibt es eine Vielfalt ekstatischer Formen, welche von einer spezifischen geistigen Bildung oder Gemütsverfassung abhängen und nicht unbedingt zur Transzendenz empor glühen müssen. Weshalb sollte es denn keine Ekstase des reinen Daseins, der immanenten Wurzeln der Existenz geben? Und erreicht man nicht eine derartige ekstatische Form in jeder Vertiefung, welche den oberflächlichen Schleier zerfasert, um den Zugang zum inneren Kern der Welt zu erleichtern?
Zu den Wurzeln dieser Welt hinabtauchen, den höchsten Rausch, die ekstatische Entzückung, die Erfahrung des Ursprünglichen und Uranfanglichen verwirklichen bedeutet, ein metaphysisches Gefühl erleben, das aus der Ekstase der wesentlichen Elemente der Schöpfung hervorgeht. Die Ekstase als Exaltation in der Immanenz, als Erleuchtung in der Welt, als Erschauen des Wahnsinns dieser Welt – dies ist das Substrat einer Metaphysik, die auch in den allerletzten Augenblicken gültig ist. Denn jede wahre Verzückung ist gefährlich. Sie gleicht der letzten Stufe der Initiation in die ägyptischen Mysterien, wo man statt der deutlichen und endgültigen Erkenntnis ausrief: »Osiris ist eine schwarze Gottheit«, das heißt, das Absolute bleibt an sich skandaloserweise unerkennbar. In der Ekstase der letzten Daseinswurzeln erblicke ich nur eine Form des Irrsinns, nicht der Erkenntnis. Dieser ekstatischen Erfahrung kann man nur in der Einsamkeit teilhaftig werden, wenn man fühlt, über dieser Welt zu schweben. Und ist die Einsamkeit denn kein Nährboden für Wahnsinn? Und ist es im Übrigen nicht bezeichnend, dass diese Ekstase sogar einem Skeptiker widerfahren kann? ist die Gegenwart der sonderbarsten Gewissheit und der wesentlichsten Vision in einem Medium von Zweifel und Verzweiflung nicht für den Wahnsinn innerhalb der Ekstase aufschlussreich?
Allein, niemand wird ekstatische Zustände erreichen ohne die vorhergehende Erfahrung der Verzweiflung, weil sowohl in jenen als auch in dieser gleichermaßen radikale Läuterungen, allerdings verschiedenen Inhalts, stattfinden.
Die Wurzeln der Metaphysik sind ebenso verwickelt wie die des Daseins.
49-50
Suprematie des Unlösbaren *
Gibt es auf dieser Erde noch irgendetwas, das nicht dem Zweifel unterworfen werden konnte, außer dem Tod, der einzig gewissen Sache hienieden? An allem zweifeln und dennoch leben ist ein Paradoxon, welches allerdings nicht zu den tragischsten gehört, weil der Zweifel bei weitem weniger inbrünstig und gespannt ist als die Verzweiflung. ist die Tatsache denn nicht bezeichnend, dass die häufigste Art des Zweifelns vom Verstand ausgeht, wobei der Mensch nur mit einem Tell seines Wesens teilnimmt, im Gegensatz zur rückhaltlosen und organischen Anteilnahme der Verzweiflung? Selbst bei den organischen und ernsten Formen des Zweifels kommt die Intensität niemals derjenigen der Verzweiflung nahe. Ein gewisser Dilettantismus und eine eigentümliche Art von Oberflächlichkeit charakterisieren den Skeptizismus im Unterschied zu einem derart komplexen und seltsamen Phänomen wie dem der Verzweiflung. Ich kann an allem zweifeln und der Welt ein verachtendes Lächeln zuwerfen, was mich indessen keineswegs hindert zu essen, ruhig zu schlafen oder mich gar zu vermahlen. In der Verzweiflung – von deren Abgründigkeit man sich nur überzeugen kann, indem man sie erleidet – sind diese Tätigkeiten nur noch unter Mühe und Schmerzen möglich. Auf der Hohe der Verzweiflung hat niemand mehr ein Anrecht auf Schlaf. Deshalb kann auch kein echter
Verzweifelter irgendetwas von seiner Tragödie vergessen: er bewahrt die schmerzende Gegenwärtigkeit seiner Not bis an die Grenze des Erträglichen im Bewusstsein.
Der Zweifel ist eine Unruhe, welche sich auf Probleme und Dinge bezieht, und ergibt sich aus der Unlösbarkeit aller bedeutsamen Fragen. Wenn sich die großen Probleme lösen ließen, würde der Skeptiker mühelos zum Normalzustand zurückfinden. Wie verschieden hingegen ist die Lage des Verzweifelten, der nicht weniger unruhig wäre, wenn alle Probleme gelöst waren, weil seine Ruhelosigkeit der Anlage seines subjektiven Daseins entspringt. Im Zustand der Verzweiflung sind Angst und Unruhe dem Dasein immanent. Niemand wird in der Verzweiflung von Problemen gemartert, sondern von den Zuckungen und Branden im eigenen Wesen. Dass hienieden nichts gelöst werden kann, ist bedauernswert. Es hat keinen gegeben und wird auch keinen geben, welcher aus diesem Grunde Hand an sich legen wurde. So wenig beeinflusst die intellektuelle Unruhe die unser ganzes Wesen umbrausende Ruhelosigkeit. Deshalb ziehe ich ein dramatisches Dasein, gepeinigt ob seines Schicksals in der Welt und von den verzehrendsten Flammen durchwütet, einem abstrakten Menschen vor, der nur von abstrakten Problemen aufgewühlt wird, von Problemen, welche den Urgrund unserer Subjektivität unangetastet lassen. Ich verachte bei dieser Denkungsart den Mangel an Tollkühnheit. Wie fruchtbar ist doch ein lebendiges, leidenschaftliches Denken, durch welches der Lyrismus wie Blut in den Adern fließt! Äußerst interessant und dramatisch ist der Vorgang, durch den Menschen, die ursprünglich von rein abstrakten und unpersönlichen Problemen bewegt und objektiv bis zur Selbstvergessenheit waren, in fataler Weise zur Grübelei über ihre eigene Subjektivität und über Probleme des Lebens und der Erfahrung genötigt würden, als Schmerz und Krankheit sie heimsuchten. Die objektiven und aktiven Menschen finden nicht genügend Wesenheiten und Quellen in sich selbst, um ihr Los bedenkenswert zu erachten und es in Frage zu stellen.
Um dein Geschick in ein subjektives und universales Problem zu verwandeln, musst du alle Stufen einer innerlichen Hölle hinabsteigen.
Wenn da noch nicht zu Asche verglüht bist, kannst du lyrisch philosophieren, dich also einer Philosophie hingeben, in welcher die Idee genauso organische Wurzeln hat wie die Poesie. Erst dann erfährst du eine höhere Form persönlicher Existenz, in der diese Welt mitsamt ihren unlösbaren Problemen nicht einmal mehr der Verachtung wert ist. Nicht etwa wegen deiner Vortrefflichkeit oder deines besonderen Wertes in der Welt, sondern weil dich Außer deiner persönlichen Agonie nichts mehr beschäftigen kann.
51-52
Widersprüche und Inkonsequenzen
Jene, die Inspiration zum Schreiben treibt, haben niemals gesorgt und werden auch nie für Einheit und System sorgen, denn ihnen ist der Gedanke ein organischer und inniger Ausdruck, der den Schwankungen und Variationen der nervösen und organischen Stimmung folgt. Die vollendete Einheit, die Bemühung um Systematik und Konsequenz zeugen von einem Leben, das armselig, schematisch und abgeschmackt ist wie die Widersprüche, welche auf eine Laune oder eine leichtfertige Paradoxie zurückgehen. Nur die heftigen und gefährlichen Widersprüche, die unlösbaren inneren Antinomien künden von fruchtbarem Geistesleben, weil nur in ihnen die innerliche Flut und der Oberfluss zur Verwirklichung gelangen. Die Menschen, die nur wenige Seelenzustände aufweisen und obendrein niemals ihre äußerste Grenze erreichen, sind außerstande, sich in Widersprüche zu verwickeln, weil ihre kümmerlichen Bestrebungen nicht in Gegensätze umschlagen können. Wer indessen den Hass, die Verzweiflung, das Chaos, die Liebe oder das Nichts in rasendem Brausen erlebt, wer sich bei jeder Regung aufzehrt, mit und in jedem Zustand allgemach erstirbt, wer nur auf den Hohen zu atmen vermag, wer immer einsam ist, besonders wenn er mit andern verkehrt; wie sollte er sich geradlinig entwickeln oder zu einem System erstarren können? Form, System, Kategorie, Zusammenhang, Ebene oder Schema, als Aspekte der und Tendenzen zur Verabsolutierung genommen, sind Auswüchse mangelnden Schöpfertums, einer Inhaltsarmut, eines Defizits an innerer Energie, einer Sterilität des Geistes. Dessen ungeheure Spannungen erreichen das Chaos und den Irrsinn der absoluten Exaltation. Kein befruchtendes spirituelles Leben ist auch nur denkbar, das die chaotischen Zustände und die aus dem Paroxysmus der Krankhaftigkeit aufschäumende Aufwallung nicht kennen wurde, sofern die Inspiration als unerlässliche Bedingung der Schaffenskraft und die Widersprüche als Manifestationen der inneren Glut erscheinen. Wer die chaotischen Zustände nicht liebt, ist alles andere als ein Schöpfer, und wer die krankhaften Zustände verachtet, hat keinerlei Recht, sich über den Geist auszulassen. Nur was der Inspiration entsprießt, hat Wert, was aus dem Abgrund unsres Wesens emporquillt, aus dem verborgenen Herzen der Subjektivität. Alles, was ausschließlich Ertrag der Arbeit, des Eifers und der Mühsal ist, besitzt keinerlei Wert, desgleichen sind die ausschließlichen Ergebnisse der Intelligenz steril und belanglos. Der barbarische und spontane Elan, das schwellende Fließen der Gemütszustände, das intime Funkeln und Zucken, der Lyrismus des Wesens und der Paroxysmus des vergeistigten Lebens, welche die Inspiration zur einzigen gültigen Wirklichkeit in der Ordnung der Schöpfungsbedingungen erheben, erfüllen mich mit schauderndem Ergötzen.
53-54

Von der Traurigkeit
Wenn die Melancholie ein verschwommener und vager Zustand der Träumerei ist, der niemals Tiefe und intensive Konzentration erreicht, so weist die Traurigkeit hingegen eine verschlossene Ernsthaftigkeit und eine schmerzliche Verinnerlichung auf. Man kann an jedem Ort traurig sein; die Traurigkeit gewinnt jedoch auf einer geschlossenen Ebene an Intensität, so wie auf einer offenen die Melancholie wachst. Die Konzentration der Traurigkeit rührt von der Tatsache her, dass diese stets einem bestimmten Motiv entspringt, während bei der Melancholie niemand irgendeine äußere Bestimmung bewusst zu gewahren vermag. Ich weiß, weshalb ich traurig, jedoch nicht, warum ich melancholisch bin. Melancholische Zustände halten lange an, ohne in einer besonderen Intensität zu gipfeln. Gerade weil ihre Dauer so ausgedehnt ist, verwischt sie im Bewusstsein jedes – in der Traurigkeit gegenwärtige – ursprüngliche Motiv, welches zwar nicht lange währt, dafür jedoch eine innige und geschlossene Intensität erreicht, die niemals losbricht, sondern im eigenen Wesen verlischt. Weder Melancholie noch Traurigkeit können je zum Ausbruch kommen oder den Menschen derart aus der Fassung bringen, dass die Bestandteile seines Wesens erschüttert wurden. ist es denn nicht bezeichnend, dass man von einem Seufzer, einem Schluchzen, aber niemals von einem Schrei aus Traurigkeit spricht? Sie ist kein überströmender, sondern ein erlöschender, dahinsterbender Zustand. Ein unterscheidendes Merkmal der Traurigkeit ist ihr häufiges Erscheinen nach den großen Befriedigung und Erfüllungen des Lebens. Weshalb folgt die Traurigkeit der geschlechtlichen Umarmung, warum wird man nach einem unmäßigen Rausch oder einem dionysischen Paroxysmus von Trübsinn befallen? Weshalb zieht der Freudentaumel Traurigkeit nach sich? Weil nach dem in diesen Exzessen verbrauchten Elan nur noch die Empfindung des Irreparablen und das Gefühl von Verlassensein und Verlust zurückbleiben, welche eine äußerst heftige Intensität negativer Ausrichtung erreichen. Man trauert nach sexuellen und dionysischen Befriedigungen, weil man anstatt eines Gewinns einen Verlust verspürt. Die Traurigkeit taucht nach allen lebenauszehrenden Erfahrungen hervor. Ihre Intensität entspricht den Verlusten. Also löst das Phänomen des Todes die tiefste Traurigkeit aus. Und ist es hinsichtlich des Unterschiedes zwischen Melancholie und Trauer nicht aufschlussreich, dass ein Begräbnis nie melancholisch genannt werden kann? Die Traurigkeit hat den ästhetischen Charakter nicht, welcher der Melancholie kaum abgeht. Es ist interessant zu beobachten, wie der Bereich des Ästhetischen sich in dem Masse einengt, wie man sich ernsten Wirklichkeiten nähert, die eine endgültige Wendung beinhalten. Der Tod ist wie das Leiden oder die Traurigkeit die absolute Verneinung des Ästhetischen. Tod und Schönheit! Zwei Begriffe, die einander absolut abstoßen. Denn ich kenne nichts widerwärtigeres, nichts Grimmigeres und Greulicheres als den Tod! Wie konnte es Dichter geben, welche den Tod, diese himmelhohe Negativität, die nicht einmal das Gewand des Grotesken anzulegen vermag, als schon empfanden? Der Tod ist die höchste Wirklichkeit der negativen Weltordnung Die Ironie ist indessen, dass man ihn desto mehr fürchtet, je starker man ihn bewundert. Und ich bekenne, dass mir die Negativität des Todes Bewunderung abringt. Es ist jedoch die einzige Sache, die ich bewundern kann, ohne sie zu lieben. Seine Erhabenheit und Unendlichkeit imponieren mir. Meine Verzweiflung ist aber derart zermürbend, dass ich kaum Hoffnung auf den Tod hege. Wie konnte ich ihn denn lieben? Über ihn kann man nur absolut Widersprüchliches schreiben. Wer nun behauptet, er habe eine genaue Vorstellung vom Tode, beweist, dass er ihn nicht einmal ahnt, obgleich er ihn in sich tragt. Und ein jeder tragt nicht nur sein Leben, sondern auch seinen Tod. Das Leben ist nichts als langwierige Agonie.
Nun scheint mir die Traurigkeit etwas von dieser Agonie widerzuspiegeln sind die Verkrampfungen der Traurigkeit denn keine agonalen Reflexe? Jeder wirklich Traurige birgt in den Augenblicken höchster Intensität Verkrampfungen die sich bis zum Wesenskern vertiefen; in seiner Physiognomie.
Diese Verkrampfungen, augenfällige Verneinungen der Schönheit, weisen so viel Verlassenheit und Vereinsamung auf, dass man zur Frage genötigt wird, ob die Physiognomie der Traurigkeit keine Objektivationsform des Todes im Leben sei. Der beeindruckende Tiefsinn und der feierliche Ernst, welche aus dieser Physiognomie der Traurigkeit hervorwachsen, ergeben sich aus der Tatsache, dass sich jene Furchen so tief graben, dass ihr Einsinken zum Symbol unserer Aufregung und unseres innerlichen Dramas wird. Das Angesicht des traurigen Menschen beweist so viel Innerlich, dass das Äußerliche das Innerste zugänglich macht. (Vorgänge, die auch bei großen Freuden stattfinden. ) Die Traurigkeit erschließt das Mysterium. Ihr Geheimnis ist indessen unversieglich und mannigfaltig, so dass sie niemals aufhört rätselhaft zu sein. Gabe es eine Stufenleiter der Mysterien, dann würde die Traurigkeit zu den unendlichen gehören, welche – weil unerschöpflich – immerfort aufleuchten.
*
Es ist eine Feststellung, die sich zu meinem Leidwesen tagtäglich bewahrt: nur jene können glücklich sein, die nicht, das heißt nur an das zum Leben Nötige denken. Denn nur ans Lebensnotwendige denken bedeutet, gar nicht denken. Das wahre Denken gleicht einem Alp, der den Lebensbronn trübt, oder einer Krankheit, die an den Wurzeln dieses Lebens nagt. Jeden Augenblick denken, auf Schritt und Tritt grundlegende Probleme aufwerfen, beständig den Zweifel am eigenen Los im Bewusstsein tragen, Lebensmüdigkeit fühlen, des Denkens und Daseins bis an die Grenze der Erträglichkeit überdrüssig sein, eine Spur von Blut und Brodem als Symbole des Dramas und Todes deines Wesens zurücklassen bedeutet, in dem Masse unglücklich sein, dass man das gesamte Phänomen des Denkens verabscheut und sich fragt, ob die Reflexivität kein auf die Menschheit herniedergeregnetes Unheil sei. Vieles ist bedauernswert in der Welt, in welcher ich nichts bedauern musste. Aber ich frage: Verdient diese Welt überhaupt mein Bedauern?
55-57
Der vollkommene Unmut
Welcher Fluch lastet auf einigen, dass sie sich nirgends wohl fühlen? Weder mit noch ohne Sonne, weder mit noch ohne Menschen. Nicht wissen, was Wohlgemutheit bedeutet, ist eindrucksvoll. Die unglücklichsten Menschen sind jene, denen das Recht auf Bewusstlosigkeit versagt bleibt. Einen erhöhten Bewusstheitsgrad haben, jeden Augenblick bewusst gewahren, allezeit des eigenen Verhältnisses. zur Welt eingedenk sein, unter einer ewigen Spannung der Erkenntnis leben bedeutet, -fürs Leben verloren sein. Die Erkenntnis ist eine Plage für dos Leben und das Bewusstsein eine klaffende Wunde im Lebenskern. Ist der Mensch denn kein dem Tode anheimgegebenes Tier? Und ist das Menschsein, das heißt ewig unzufrieden zwischen Leben und Tod gespannt zu sein, keine Tragödie? Ich bin des Menschseins vollkommen überdrüssig oder, genauer, davon erdrückt. Wenn ich konnte, wurde ich sofort darauf verzichten, was soll jedoch aus mir werden: ein Tier? Es gibt kein Zurück. Und außerdem liefe ich Gefahr, ein der Philosophiegeschichte kundiges Tier zu werden. Übermensch zu werden scheint mir unmöglich und töricht, ein lächerlicher Einfall. Wurde das Überbewusstsein nicht einer Lösung des Problems Näherkommen? Konnte man nicht jenseits leben, nicht diesseits (zur Animalität hin) der komplexen Bewusstseinsformen, jenseits von Unruhen und Qualen, von nervösen Störungen und geistigen Erfahrungen, in einem Daseinsbereich, wo die Pforte zur Ewigkeit kein bloßer Mythos wäre? Ich für meinen Teil trete aus der Menschheit zurück. Ich kann und will kein Mensch mehr sein. Denn was konnte ich in dieser Eigenschaft noch tun? Soll ich an einem sozialpolitischen System tüfteln oder ein Mädchen ins Unglück stürzen? Sollte ich etwa noch den Inkonsequenzen philosophischer Gedankengebäude nachspüren oder mich der Verwirklichung ethischer oder ästhetischer Ideale befleißigen? Alles dies scheint mir allzu kümmerlich. Und selbst wenn es mehr wäre, was zuweilen vorkommt, wurde es mich dennoch nicht anziehen. Ich verzichte auf mein Menschsein, obgleich ich auf den Stufen, die ich steige, allein sein werde, absolut einsam. Bin ich denn nicht bereits derart einsam in dieser Welt, von der ich nichts mehr zu erwarten habe? In einem Überbewusstsein jenseits aller üblichen Ideale und alter alltäglichen Regungen ließe sich vielleicht noch atmen. Dort würde ein Ewigkeitsrausch allen Tand dieser Welt zunichtemachen und keine innerliche Pein die Ekstase der Ewigkeit trüben, in der das Wesen ebenso rein und immateriell wäre wie das Nichtsein.
58-59
Das Feuerbad
Es gibt so viele Wege zur Empfindung der Körperlosigkeit, dass die Aufstellung einer Hierarchie ein äußerst schwieriges, wenn nicht gar müßiges Unterfangen bedeutet. Denn jeder erreicht eine derartige Empfindung gemäß der Struktur seines Temperaments oder infolge des Vorwaltens einiger spezifischer Elemente im entscheidenden Augenblick. Dessen ungeachtet glaube ich, dass das Feuerbad eigentlich der fruchtbarste Versuch ist, einer solchen Empfindung teilhaftig zu werden. In deinem ganzen Wesen ein verzehrendes Brennen fühlen und eine durchbohrende Glut, spüren, wie wabernde Flammen in dir wachsen und dich wie in einer Holle umschlingen, selbst Blitz und Funke sein, das heißt ein Feuerbad. Wie jedes Bad bewirkt es eine Läuterung, eine Reinigung von Teilen, die sogar das Dasein ausloschen kann. Verbrennen die Glutwogen und aufschlagenden Lohen nicht den Keim der Existenz, zehren sie nicht am Leben, beschranken sie nicht den Elan auf eine bloße Sehnsucht, indem sie ihm den herrschsüchtigen Charakter rauben? Im Feuerbad leben, das Spiel einer innerlichen, flammenumhatterten Glut fühlen: bedeutet dies nicht, immaterielle Lauterkeit erreichen, eine dem flackernden Flammentanz gleichende Unkörperlichkeit? Verwandelt die Befreiung von der Schwere, die Entbindung von den Anziehungskräften, welche in diesem Feuerbad ausgelost wird, das Leben nicht in ein Trugbild oder einen Traum? Allein, auch diese verblassen angesichts der endgültigen Empfindung, welche zu den paradoxesten und absonderlichsten gehört, wenn man von der Empfindung jener traumhaften Unwirklichkeit zum Gefühl des zu Asche Zerfallens getrieben wird. Es gibt kein inneres Feuerbad, dessen letzte Wirkung nicht ein wundersamer Wirbel wäre, der dem Gefühl der Aschewerdung entspringt und die Körperlichkeit unweigerlich sprengt. Welches Lebensgefühl konntest du noch empfinden, wenn die innerlichen Lohen in dir alles verbrannt haben, wenn nichts mehr von deiner individuellen Existenz überlebt, wenn nur noch Asche übrigbleibt? Ich verspüre eine irrsinnige Wollust von unendlicher Ironie, wenn ich mir vorstelle, dass meine Asche in rasender Windeseile in die vier Weltenwinkel verweht und als ewige Rüge dieser Welt in den Raum verstreut würde.
60
Vom Leben abfallen
Nicht alle Menschen sind der Naivität verlustig gegangen; deshalb sind nicht alle unglücklich. Jene, die naiv im Dasein eingewurzelt sind, nicht aus Torheit oder Imbezillität – denn die Naivität schließt derartige Schwachen aus, weil sie ein lauterer Zustand ist -, sondern aus der instinktiven und organischen Liebe zum natürlichen Reiz der Welt, welchen die Naivität allzeit entdeckt, jene erreichen eine Harmonie und verwirklichen eine Integration ins Leben, welche es durchaus verdient, von den auf der Verzweiflung Hohen Umherirrenden beneidet zu werden. Die Desintegration aus dem Leben entspricht einem völligen Verlust der Naivität, dieser entzückenden Gabe, welche durch die Erkenntnis, den erklärten Widersacher des Lebens, zermalmt wurde. Das Erleben des Alls, das sich am Dasein Ergötzen und dem pittoresken Wesen individueller Aspekte, die Entzückung durch den spontanen Zauber der Schöpfung, das unbewusste Erleben der Widersprüche, das ihren tragischen Charakter aufhebt, sind Ausdrucksweisen der Naivität, eines für die Liebe und den Enthusiasmus ergiebigen Grundes. Die Widersprüche nicht qualvoll ins Bewusstsein projizieren bedeutet, die jungfrauliche Wonne der Naivität erreichen, zur Tragödie und zum Todesbewusstsein, welchen eine verwirrende Komplexität und eine paradoxe Zersetzungsgewalt zugrunde liegen, unfähig sein.
Die Naivität ist dem Tragischen gegenüber undurchlässig, der Liebe aber aufgeschlossen, denn der naive Mensch hat, weil er von seinen inneren Widersprüchen nicht verzehrt wird, genügend Reserven, um sich hinzugeben. Für den vom Leben Abgefallenen gewinnt das Tragische eine äußerst schmerzvolle Intensität, weil sich die Widersprüche nicht nur in ihm selbst, sondern zwischen der Welt und ihm entfalten. Es gibt nur zwei grundlegende Haltungen: die naive und die heroische. Die übrigen sind Nuancen dazwischen. Um nicht an Geistesschwache zu sterben, musst du nur zwischen diesen beiden wählen. Weil die Naivität für den vor diese Alternative Gelangten ein verlorenes Gut ist, dessen Rückgewinnung durchaus zweifelhaft erscheint, bleibt nur noch der Heroismus. Die heldenhafte Haltung ist Vorrecht und Fluch der vom Leben Abgefallenen, der vom Sein Entbundenen und zu jeglicher Befriedigung oder Seligkeit Unfähigen. Held sein – im universalen Sinne des Wortes – bedeutet einen absoluten Triumph wünschen. Dieser Triumph kann jedoch durch den Tod errungen werden. Jede Heldentat bedeutet eine Transzendierung des Lebens, welche in fatalerweise einen Sprung ins Nichts voraussetzt. Und jeder Heroismus ist ein Heroismus des Nichts, selbst wenn dies nicht ins Bewusstsein des Helden dringt, selbst wenn er nicht gewahrt, dass sein Aufschwung von einem Leben ausgeht, das alle normalen Triebkräfte verloren hat. Al[es, was nicht der Naivität entquillt und nicht zur Naivität führt, ist dem Nichts preisgegeben. Gibt es irgendeine Lockung des Nichts im Menschen? Gewiss ist sie viel zu geheimnisvoll, als dass wir sie durchschauen konnten. Da ich indessen die Verlockungen des naiven Lebens verlasse oder zu verlassen gezwungen bin, um mich sinnlos in die Welt zu stürzen – denn mein Heroismus ist grotesk und ermangelt der Vision des Triumphs -, muss es jene mysteriöse Anziehung geben.
61-62
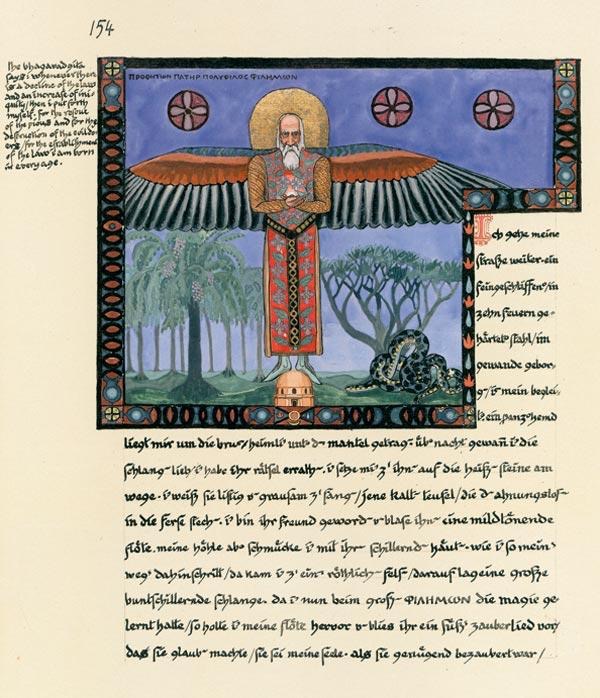
Von der Wirklichkeit des Leibes
Ich werde nie begreifen, wie es so vide Menschen geben konnte, welche den Leib für eine Illusion erklärt haben, so wie mir auch niemals einleuchten wird, wieso man sich den Geist außerhalb des Dramas des Lebens vorstellen konnte, außerhalb der Widersprüche und Schwachen desselben.
Offensichtlich hatten jene Menschen kein Bewusstsein des Fleisches, der Nerven und jedes einzelnen Organs. Aber ich werde nie verstehen, weshalb es ihnen abging, obgleich ich in dieser organischen Bewusstlosigkeit eine wesentliche Bedingung der Seligkeit vermute. Jene, die sich nicht von der Untergründigkeit des Lebens losgerungen haben, die in ihren organischen, dem Einbruch des Bewusstseins vorausgehenden Rhythmus eingebettet sind, erreichen einen Zustand, in dem die Wirklichkeit des eigenen Leibes Je ” Augenblick im Bewusstsein gegenwärtig ist. Denn jene Gegenwart der leiblichen Realität im Bewusstsein deutet auf eine wesentliche Krankheit des Lebens hin. ist es denn keine Krankheit, unausgesetzt die wesenseignen Nerven und Glieder, den Magen und das Herz bewusst zu spüren, dem Bewusstsein jedes einzelnen Teils ausgesetzt zu sein? Zeugt dieser Vorgang nicht von einer Zersetzung dieser Teile, von einem Versagen ihrer natürlichen Funktionen? Des Leibes Wirklichkeit gehört zu den schrecklichsten.
Ich mochte sehen, was der Geist ohne die Gärungen des Fleisches bedeuten wurde, oder das Bewusstsein ohne eine überspannte nervöse Empfindlichkeit.
Wie konnten die Menschen das Leben ohne Körper austüfteln oder die autonome und ursprüngliche Existenz des Geistes ersinnen?
Das haben nur jene, die keinen Geist besitzen, sich ausdenken können, die gesunden und bewusstlosen Menschen. Denn der Geist ist die Frucht einer Krankheit des Lebens und der Mensch nur ein erkranktes Tier. Das Vorhandensein des Geistes ist eine Anomalie im Leben. Ich habe auf so vieles verzichtet, warum nicht auch auf den Geist? Aber ist der Verzicht nicht eher eine Krankheit des Geistes als eine des Lebens?
63
Ich weiß nicht
Ich weiß nicht, was gut und böse, was erlaubt und was unerlaubt ist; ich kann weder verdammen noch loben. Es gibt kein gültiges Kriterium und kein konsistentes Prinzip in dieser Welt. Es wundert mich, da8 einige sich noch der Erkenntnistheorie befleißigen. Um ehrlich zu sein, gestehe ich, dass mich die Relativität unserer Erkenntnis wenig kümmert, denn diese Welt verdient nicht, erkannt zu werden. Ich verspüre oftmals das Gefühl einer allumfassenden Erkenntnis, welche den ganzen Inhalt dieser Welt erschöpft, während ich andere Male nichts von dem begreife, was um mich herumwirbelt. Ich fühle einen bitteren Geschmack in mir, eine teuflische, bestialische Bitternis, wenn mir selbst das Problem des Todes schal erscheint. Zum erstenmal bemerke ich, wie schwer diese Bitterkeit zu definieren ist. Vielleicht auch deshalb, weil ich nach theoretischen Gründen suche, während sie vorzugsweise einer prätheoretischen Region entspringt.
In diesem Augenblick glaube ich an überhaupt nichts und habe keinerlei Hoffnung. Alle Ausdrucksweisen und Gegebenheiten, welche dem Leben Reiz verleihen, erscheinen mir sinnlos. Ich habe weder das Gefühl der Vergangenheit noch das der Zukunft, und die Gegenwart dünkt mich Gift. Ich weiß nicht, ob ich verzweifelt bin, denn Hoffnungslosigkeit kann auch etwas anderes sein als Verzweiflung. Keine Bezeichnung konnte mich verdrießen, denn ich habe nichts mehr zu verlieren. Wie ich alles verloren habe! Und wenn ich bedenke dass jetzt Blüten aufgehn und Vogel singen! Wie bin ich doch allem entrückt!
64
Die individuelle und die kosmische Einsamkeit
Es gibt zwei Weisen, die Einsamkeit zu erleben: dich einsam in der Welt und die Einsamkeit der Welt zu fühlen. Wenn du dich einsam fühlst, erlebst du ein rein individuelles Drama; das Gefühl des Verlassenseins ist sogar im Rahmen der natürlichen Herrlichkeit möglich. In diesem Falle sind nur die Unruhen deiner Subjektivität von Bedeutung. Dich in die Welt geworfen und ihr enthoben fühlen, unfähig, dich ihr anzupassen, im Innern aufgezehrt, von deinen eigenen Schwachen und Schwärmereien zerrieben, von deinen Unzulänglichkeiten gemartert, ungeachtet der äußeren Erscheinungen der Welt, die leuchtend oder duster sein können, wahrend du in dem gleichen innerlichen Drama verfangen bleibst, alles das bedeutet individuelle Einsamkeit. Das Gefühl der kosmischen Einsamkeit leitet sich, obgleich es auch im Einzelnen stattfindet, weniger von der rein subjektiven Unruhe her als von der Empfindung der Verlassenheit dieser Welt, vom äußeren Nichts. Es ist, als verschwände alle Pracht dieser Welt, um von der wesentlichen Monotonie eines Gräberfeldes versinnbildlicht zu werden. Vide werden von der Vision einer verlassenen, unheilbar einer eisigen Einsamkeit anheimgefallenen Welt, die nicht einmal vom zitterigen Abglanz des Dämmerlichtes gestreift wird, gepeinigt. Wer ist unglücklicher, jene, welche die Einsamkeit in sich, oder jene, welche sie außerhalb, in der Außenwelt fühlen? Unmöglich, eine Antwort zu finden. Aber weshalb sollte mich die Hierarchie der Einsamkeiten beunruhigen? ist es denn nicht genug, dass man überhaupt in einer beliebigen Weise einsam ist?
*
Ich gebe es der Nachwelt schriftlich, dass es hienieden nichts zu glauben gibt und dass die einzige Rettung das absolute Vergessen ist. Ich wollte alles vergessen, mich gänzlich vergessen, nichts mehr von mir und der Welt wissen. Die wahren Bekenntnisse kann man nur mit Tranen niederschreiben. Aber meine Tranen würden diese Welt überfluten, wie mein innerliches Feuermeer sie in Brand setzen wurde. Ich brauche keinerlei Stutzen und Krucken, keinen Ansporn und kein Mitleid, denn, wiewohl ich der verkommenste aller Menschen bin, fühle ich mich nichtsdestoweniger überaus kräftig, gewaltig und furchterregend! Ich bin der einzige Mensch, der ohne jegliche Hoffnung lebt. Das ist der Höhepunkt des Heldentums, der Paroxysmus und die Paradoxie des Heroismus. Höchster Wahnsinn! Ich müsste meine ganze chaotische und verwirrte Leidenschaft aufbieten, am alles zu vergessen, um nichts mehr zu sein, um mich des Geistes und des Bewusstseins zu erledigen. Ich habe auch eine Hoffnung: die Hoffnung auf das absolute Vergessen. Aber ist das noch Hoffnung, ist es nicht vielmehr Verzweiflung? ist diese Hoffnung nicht die Verneinung aller künftigen Hoffnungen? Ich will nichts mehr wissen, nicht einmal, dass ich nichts weiß. Weshalb so viele Bedenken, Diskussionen und Verdruss?
Warum soviel Todesbewusstsein? Wie lange noch soviel Versonnenheit und Grübelei?
65-66
Apokalypse
Wie sehnlich wünschte ich mir, dass eines Tages alle Menschen, die Beschäftigungen oder Aufgaben nachgehen, ob verheiratet oder ledig, jung oder betagt, ernsthaft oder liederlich, traurig oder frohgemut, ihre Behausungen und Dienstraume verließen und, alle ihre Pflichten und Ämter aufgebend, auf die Straßen flohen und nichts mehr tun wollten. Alle diese vertierten Menschen, die ohne jeglichen Sinn arbeiten oder sich über ihren persönlichen Beitrag zum Wohle der Menschheit hinwegtäuschen, die, vom verhängnisvollsten Trug getrieben, sich um künftiger Generationen willen abschuften, würden in solchen entscheidenden Augenblicken die Rache für die ganze Mediokrität eines nichtigen und sterilen Lebens begierig erleben, für die ganze Verschwendung, die nichts von der Herrlichkeit hehrer Verklärungen ahnen ließ. Ich würde jene Augenblicke genießen, in denen keiner der Gaukelei des Ideals mehr bedurfte, wenn nicht jede Befriedigung in unmittelbarer Lebendigkeit durchlebt werden konnte, jede Resignation vergeblich wäre und alle Schranken des normalen Lebens endgültig in Scherben geschlagen würden. Alle Menschen, welche im stillen
leiden und sich nicht einmal getrauen, ihre Verbitterung in Tränen auszuschütten, würden dann in einem Chor von unheimlicher Disharmonie aufbrüllen, mit sonderbaren Schreien, welche die Erde beben ließen. Die Wasser sollen schneller fließen und die Berge bedrohlich wanken, die Baume ihre Wurzeln als ewige und greuliche Rüge emporrecken, die Vogel krächzen wie Raben und das Getier aufgeschreckt bis zur Erschöpfung dahinjagen. Alle Ideale sollen für nichtig, die Glaubensbekenntnisse für Tand, die Kunst für eine Luge und die Philosophie für einen Scherz erklärt werden. Alles sei Aufstieg und Absturz. Erdschollen schwingen sich in die Lüfte auf und sind sodann in alle Winde zerstoben; Pflanzen ziehen bizarre Schnörkel, gewundene und groteske Schlangenlinien am Himmelsgrunde und bilden entstellte und beängstigende Fratzen. Feuerwirbel wachsen in wildem Rhythmus, und ein barbarisches Tosen überwuchere die ganze Welt, damit auch das winzigste Tier erfahre, dass das Ende bevorsteht. Alles Geformte werde amorph, und das Chaos verschlinge im universalen Strudel alles, was dieser Welt Bestand und Gestalt verleiht. Es breche irrsinniges Toben los, betäubendes Gedröhn, Grausen und Gebrause, wonach ewiges Schweigen und endgültiges Vergessen einkehren. In solchen endgültigen Augenblicken sollten die Menschen einer solchen Temperatur ausgesetzt werden, dass alles, was die Menschheit bisher an Reue, Sehnsucht, Liebe, Verzweiflung oder Hass empfand, in ihrem Innern ausbricht und sie aushöhlt, bis nichts mehr übrigbleibt. Wenn alle Menschen ihre Beschäftigungen verließen, wenn niemand in der Mittelmäßigkeit der Pflichten noch einen Sinn erkennte, wenn das Dasein unter seinen inneren Widersprüchen einstürzte, was würde die allerletzte Apotheose des Nichts überleben?
67-68

Das Monopol des Leidens
Ich frage mich: Weshalb leiden nur einige? Liegt irgendein Grund in dieser Selektion, die aus der Reihe der normalen Menschen eine Kategorie Auserwählter herausgreift, am sie den schauerlichsten Folterungen zu unterwerfen? Einige Religionen behaupten, dass die Gottheit dich durch Leiden auf die Probe stellt oder dass du dadurch Übel oder Unglauben abbüßt. Allein, diese Vorstellung kann far den religiösen Menschen gelten, nicht jedoch für denjenigen, der sieht, wie das Leiden Menschen ungeachtet ihres Wertes heimsucht, ja sogar bisweilen häufiger Unschuldige und Lautere beschleicht. Im Leiden gibt es keinerlei Rechtfertigung von Werten. Die Begründung des Leidens auf einer Rangordnung der Werte ist unmöglich. Und schließlich ist es fragwürdig, ob eine solche Hierarchie überhaupt denkbar ist.
Die sonderbarste Erscheinung bei den Leidenden ist der Glaube an ihr absolutes Leid, der sie an eine Art Monopol des Leidens glauben lasst. Ich habe den Eindruck, dass nur ich leide, dass die ganze Drangsal dieser Welt sich in mir zusammenballt, dass ich allein das Vorrecht auf Leiden habe, wenngleich ich mir durchaus bewusst bin, dass es bei weitem schrecklichere Leiden gibt: Du kannst sterben, indem das zerfetzte Fleisch sich vom Leibe ablöst und du unter den eigenen Blicken bei vollem Bewusstsein zur Illusion schrumpfst. Es gibt monströse, verbrecherische und unzulässige Leiden. Man fragt sich: Wie kommen sie überhaupt vor, und wenn sie vorkommen, wie kann man noch von Finalität oder anderen Lügengespinsten sprechen? Ich bin angesichts des Leidens derart beeindruckt, dass ich verzage. Und ich verzage, weil ich nicht verstehe, weshalb es Leiden auf der Welt gibt. Seine Abstammung von der Bestialität, der Untergründigkeit und Dämonik des Lebens erklärt die Gegenwart des Leides, rechtfertigt es aber nicht. Es ist vielleicht wahrscheinlich, dass das Leiden, wie das Sein im allgemeinen, sich jeglicher Rechtfertigung entzieht. Hat es überhaupt Sein geben müssen? Gibt es einen Grund dazusein? Oder hat die Existenz nur einen immanenten Grund? Existiert das Dasein nur als Dasein? ist das Sein nur Sein? Warum nicht einen endgültigen Triumph des Nichtseins annehmen, warum nicht annehmen, dass das Dasein zum Nichtsein führt und das Sein zum Nichts? ist die einzige absolute Wirklichkeit nicht doch das Nichtsein? Eine ebenso große Paradoxie wie die Paradoxie der Welt.
Obwohl mich das Phänomen des Leidens beeindruckt und mitunter entzückt, konnte ich dennoch keine Apologie des Leidens verfassen, weil das beständige Leid – und es gibt kein wahres Leiden als das beständige – zwar in der ersten Phase läutert, in den letzten jedoch verblödet, zerrüttet, verwüstet und uns in einen Zustand der Anarchie stürzt, bis wir zerfallen. Die leichtfertige Begeisterung für das Leiden, die sich in Ausrufen kundtut, ist charakteristisch für die Ästheten und die Dilettanten des Leidens, die es einer Zerstreuung gleichsetzen und nicht verstehen, welche grauenhafte Verwesungskraft es in sich birgt, wieviel Zersetzungswut und wieviel Gift, aber auch wieviel Fruchtbarkeit, welche dich indessen teuer zu stehen kommt. Das Monopol des Leidens besitzen heißt, über einem Abgrund schwebend dahinleben. Denn wahres Leiden ist abgründig.
*
Wieviel Feigheit liegt in der Vorstellung jener, die behaupten, der Selbstmord sei Lebensbejahung! Um ihren Mangel an Kühnheit zu verbergen, ersinnen sie verschiedene Grunde, die ihre Unfähigkeit entschuldigen sollen. In Wirklichkeit gibt es keinen rationalen Willen oder Entschluss sich selbst zu toten, sondern lediglich organische, innige Triebe, welche dich zum Selbstmord vorherbestimmen.
Die Selbstmörder fühlen einen pathologischen Antrieb zum Tode, dem sie sich zwar bewusst widersetzen, den sie aber doch nicht unterbinden können. Das Leben hat ein solches Ungleichgewicht in ihnen erreicht, dass kein rationale! Grund es mehr zu verfestigen vermag. Es gibt keine Selbstmorde, die aus rationalen Entscheidungen oder aus Reflexionen über die Sinnlosigkeit der Welt oder das Nichts dieses Lebens hervorgehen. Und wenn man uns den Fall jener antiken Weisen entgegenhält, die in der Einsamkeit den Freitod wählten, so entgegne ich, dass ihr Selbstmord nur auf Grand der Tatsache möglich war, dass sie ihr Leben im Inneren ausgelöscht, dass sie jedes Lebensflackern, jede Lebensfreude, jede Versuchung erstickt hatten. Viel über den Tod oder andere gefährliche Probleme nachdenken bedeutet, dem Leben gewiss einen mehr oder weniger tödlichen Stoß versetzen; aber es ist nicht weniger wahr, dass jener Leib, in dem sich solche Probleme walzen, angegriffen sein musste, um diese Gedanken zu gestatten. Die gleichen widrigen äußeren Bedingungen lassen manche gleichgültig, verstören einige und treiben wiederum andere zum Selbstmord. Um zur zwanghaften Idee des Selbstmords zu gelangen, ist so viel innerliche Erregung nötig, so viel Drangsal und ein so heftiges Aufbrechen innerer Schranken, dass vom Leben nur ein katastrophaler Schwindel, ein dramatischer Wirbel und eine eigentümliche Ruhelosigkeit übrigbleiben.
Wie sollte der Freitod eine Lebensbejahung sein? Man pflegt zu sagen: Da verübst Selbstmord, weil dich das Leben enttäuscht hat. Folglich hast du es gewünscht, etwas von ihm erwartet, was es dir versagen musste. Welch falsche Dialektik! Als hatte der Selbstmörder, bevor er starb, nicht gelebt, keine Hoffnungen, Schmerzen oder Verzweiflungen gehabt. Die wichtigste Tatsache beim Selbstmord ist ja, dass man nicht mehr leben kann, was durchaus nicht in einer Laune, sondern in der erschütterndsten Tragödie des Lebens wurzelt. Und bedeutet nicht mehr leben können: das Leben bejahen? Jeder eigentliche Selbstmord ist eindrucksvoll. Es verwundert mich, dass die Menschen nach Gründen und Ursachen suchen, um die Selbstmorde hierarchisch einzustufen oder am allerlei Rechtfertigungen dafür zu finden, falls sie ihn nicht geringschätzen. Ich kann mir kein törichteres Problem vorstellen, als eine Hierarchie der Selbstmorde zu entwerfen, die sich auf Selbstmorde aus hehren oder gemeinen Gründen berufen würde. ist die Tatsache, sich das Leben zu nehmen, nicht so überwältigend, dass jede Suche nach Motiven kleinlich erscheint? Ich empfinde die größte Verachtung jenen gegenüber, welche sich über die Selbstmorde aus Liebe lustig machen, weil sie nicht verstehen, dass eine Liebe, die nicht verwirklicht werden kann, für den Liebenden eine Auflösung seines Wesens bedeutet, einen vollständigen Sinnverlust, die Unmöglichkeit, im Sein zu
bestehen. Wenn damit ganzer Seele, mit aller subjektiven Daseinsfülle liebst, so kann das Scheitern dieser Liebe nur den Zusammenbruch deines Wesens bewirken. Ungestüme Leidenschaften treiben, falls sie nicht befriedigt werden, schneller in den Tod als die großen Schwachen. Denn in diesen zehrt man sich in einer allmählichen Agonie auf, während man in den vereitelten Leidenschaften wie ein Blitz erlischt. Ich bewundere nur zwei Kategorien von Menschen: die jederzeit von Sinnen geraten und die jeden Augenblick Selbstmord begehen können. Nur diese imponieren mir, weil in ihnen gewaltige Leidenschaften wallen und sich erhabene Verklärungen entfalten. Jene, welche das Leben positiv erleben, die Sicherheit jedes Augenblicks erfahrend, von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft angetan, erfreuen sich nur meiner Achtung. Nur jene, die allezeit mit den letzten Wirklichkeiten in dramatische Berührung kommen, erschüttern mich bis an den Rand des Ertragens.
Warum ich nicht Selbstmord verübe? Weil mich sowohl das Leben als auch der Tod anwidern. Ich bin ein Mensch, der in einen Flammenkessel geworfen werden musste. Ich verstehe absolut nicht, was ich in dieser Welt zu suchen habe. Ich fühle augenblicklich das Bedürfnis zu schreien, ein Gebrüll auszustoßen, das der ganzen Welt Grausen einjagte, das alle zittern und zucken und in einem Schauderwahn bersten ließe. Ich fühle einen schrecklichen Banner in mir schlummern und wundere mich, dass er nicht losbricht, am diese Welt zu vernichten, die ich für immer und ewig in mein Nichts verschlingen wollte. Ich fühle mich als das zerstörungswütigste Geschöpf, das jemals in der Geschichte weste, eine apokalyptische Ausgeburt voller Flammen und Finsternis, von Wucht und Verzweiflung beseelt. Ich bin ein Untier mit groteskem Lächeln, das sich bis zur Illusion in sich selbst zusammenzieht und sich ins Unermessliche ergießt, das zugleich stirbt und wachst, verzückt zwischen Fülle und Leere, taumelnd zwischen der Hoffnung des Nichts und der Verzweiflung des Alls, von Düften und Giften genährt, von Liebe und Hass durchglüht, von Lichtern und Schatten zermalmt. In mir erlischt alles, was glänzt und gleißt, um als Blitz und Donner aufzuerstehen. Und brennt nicht selbst die Düsternis in mir?
69-72
Der absolute Lyrismus
Ich mochte in radikaler Explosion ausbrechen mit allem, was ich in mir trage, mit aller Energie und allen Inhalten Zerfließen, mich zersetzen: meine Verwüstung sei in unmittelbarem Ausdruck mein Werk, meine Schöpfung und Inspiration. Ich wollte mich in der Zerstörung verwirklichen, mich mit rasendem Elan über alle Massen und Grenzen emporschwingen: Mein Tod sei mein Triumph. Ich mochte, dass ich in der Welt und die Welt in mir zerschmelze, dass wir in unserer Tollheit einen apokalyptischen Traum gebaren, absonderlich wie alle Untergangsvisionen und erhaben wie die großartigen Dämmerungen. Aus dem Geflecht unseres Traumes mögen rätselhafte Herrlichkeiten und bestrickende Schatten, sonderbare Gestalten hervorwachsen und schwindelerregende Abgründe gähnen. Ein Spiel von Licht und Schatten kleide den Untergang in einen phantastischen Dekor, und eine kosmische Verklärung erhebe alles über das Erträgliche hinaus, wenn der Aufschwung zum Nichts losschnellt und die Formen in einer Exaltation der Agonie und Beseligung zerspringen. Ein allumfassendes Feuer verschlinge diese Welt, und sein Lohen – einschmeichelnder als Weiberlächeln und immaterieller als die Melancholie – lose Dämmerungswonnen aus: labyrinthisch wie der Tod und behexend wie in der Traurigkeit das Nichts. Es bedarf irrsinniger Erfahrungen, damit der Lyrismus zum Äußersten Ausdruck komme, damit seine Spannungen die Grenzen des normalen Subjektivismus überschreiten. Der absolute Lyrismus ist der lyrische Ausdruck der letzten Augenblicke. Denn im absoluten Lyrismus verschmilzt der Ausdruck mit der Wirklichkeit: Der Ausdruck ist alles, ist das Wesen in einer bestimmten Hypostase. Er hört auf, eine untergeordnete und bedeutungslose Partialobjektivation zu sein, und wird Teil von dir. Dabei ist nicht nur Sensibilität oder Intelligenz maßgeblich, sondern das ganze Wesen, der ganze Leib, das ganze Leben in dir mit seinem Rhythmus und seinem Pochen. Der vollkommene, absolute Lyrismus ist das auf die Stufe der absoluten Selbsterkenntnis erhobene Schicksal. Niemals wird dieser Lyrismus einen unbeteiligten Ausdruck annehmen können, vielmehr ist jeder Ausdruck ein Stuck von dir. Aus diesem Grunde ist er nur in den entscheidenden Momenten gegenwärtig, wenn sich die aus gedruckten Zustünde mit dem Ausdruck zugleich aufzehren. Das Gefühl der Agonie, das komplexe Phänomen des Dahinsterbens, wenn der Ausdruck sich manifestiert und verbraucht, ist eine Überlagerung von Tat und Realität, denn die Tat ist keine Manifestation der Realität mehr, sondern wird zur Realität selbst. Der absolute Lyrismus – dieser unbändige Antrieb sich zu objektivieren – liegt jenseits der Poesie, der Sentimentalität … Er nähert sich eher einer Art von Metaphysik des Schicksals an, denn in ihm manifestieren sich eine vollkommene Aktualität des Lebens und der tiefste Inhalt des Wesens, um sich auf die eine oder andere Weise zu losen. In der Regel lost der absolute Lyrismus alles im Sinne des Todes. Denn alles Entscheidende ist mit dem Tode unentwirrbar verflochten.
*
Ich fühle, dass unter mir ein dunkler und bodenloser Abgrund sich auftun musste, um mich für alle Zeiten in ewige Nacht zu verschlingen. Und es erstaunt mich, dass dieser Vorgang sich nur im Gefühl, nicht aber in der Wirklichkeit entfaltet. Nichts erschiene mir in diesen Augenblicken natürlicher, als dass ich in die Tiefen der Finsternis versänke, wo die schale Klarheit dieser Welt keine Spur eines Widerscheins mehr hinterlasst. Ich suche nicht nach einer organischen Erklärung dieses inneren Triebes zum Finsteren, weil ich keine für den Lichtrausch zu finden vermag. Ratlos überlege ich mir indessen, welchen Sinn der Wechsel zwischen einer Erfahrung des Lichtes und einer Erfahrung des Dunkels haben konnte. Die Vorstellung der Polarität dünkt mich unzureichend, denn in der Hinneigung zum Reich der Nacht liegt eine beträchtlich tiefere Unruhe, die nicht einem Schema der Natur oder einer Geometrie des Daseins entsprießt. Das Gefühl, von der Nacht verschlungen zu werden, von einer Nacht, die unter dir klafft, ist nur dann möglich, wenn du eine lastende Schwere auf dem Gehirn und im ganzen Wesen spurst, wie der Druck nächtlicher Unermesslichkeit auf dem gesamten Organismus. Wie mich die gierige Nacht dieser Welt für immer und ewig verschlingen wird!
*
Empfindung absoluter Verwirrung. Nicht mehr unterscheiden, differenzieren und einordnen, nichts mehr erklären, verstehen und einschätzen können. Die Empfindung dieser Konfusion macht aus jedem Philosophen einen Dichter, nicht alle Philosophen können sie indessen erreichen und mit beständiger Intensität erleben. Denn wenn sie diese erlangten, konnten sie nicht mehr abstrakt und starr philosophieren. Der Vorgang, durch den ein Philosoph zum Poeten wird, ist voller Dramatik. Aus der endgültigen Welt der Formen und abstrakten Probleme stürzt man in einem Gefühlswirbel in die Wirrsal und den Wust aller Seeleninhalte, welche sich zu seltsamen und chaotischen Gebilden verschränken. Wie soll man denn noch abstrakte Philosophie treiben, wenn im Innern ein gewaltiges Drama entflammt, in welcher die erotische Ahnung der qualvollen metaphysischen Unruhe, die Todesangst der Sehnsucht nach Naivität, die vollständige Entsagung einem paradoxen Heroismus, die Verzweiflung der Hoffart, die Vorahnung des Wahnsinns dem Wunsch nach Anonymität, der Schrei dem Schweigen, der Elan dem Nichts begegnet? Und alles geschieht zur gleichen Zeit, simultan.
Alle diese Triebe keimen in tosender Wallung auf, in rasender Tollheit und absoluter Wirrsal.
Wie konnte man dann noch der systematischen Philosophie nachgehen und wie noch einer wohlgeordneten Architektonik fähig sein?
Es gibt Menschen, welche in der Welt der Formen begonnen haben und in der absoluten Konfusion enden. Deshalb können sie nur noch poetisch philosophieren. In der absoluten Verirrung zahlt nichts mehr, des Wahnsinns Schmerzen und Lüste ausgenommen.
73-75

Das Wesen der Gnade *
Es gibt viele Wege, auf denen man eine Losbindung van der Erde, einen Aufschwung und eine Erhöhung über die blinde Lebenserhaltung erreichen kann. Es gibt aber nur die Gnade, deren Entbindung van der Erde kein Abreißen der Beziehung zu den urgründigen Lebenskräften bedeutet, sondern einen sinnlosen Sprung, einen selbstlosen Auftrieb, in dem der naive Reiz und der untergründige Rhythmus des Lebens ihre heilsame Frische bewahren. Jede Gnade ist Aufflug, emporhebender Freudentaumel.
Die anmutigen Bewegungen mit ihrem Schlängeln erwecken den Eindruck des Schwebens über der Welt, des leichten und immateriellen Fluges. Ihre Spontaneität gleicht der Leichtigkeit des Flügelschlages, der Natürlichkeit eines Lächelns und der Lauterkeit eines Frühlingstraumes. Hat die Anmut nicht im Tanz ihre lebendigste Verwirklichung gefunden? Im anmutigen Lebensgefühl wird sie als unkörperliche Spannung empfunden, wie ein reiner Strom van Lebenskraft, der niemals über die jedem graziösen Rhythmus innewohnende Harmonie hinausgeht. In jeder Gnade liegt ein Lebenstraum, ein selbstloses Spiel, eine Ausweitung, welche ihre Grenzen in sich selbst, nicht in der Außenwelt findet. Deshalb vermittelt die Gnade die labende Illusion der Freiheit, der spontanen und unmittelbaren Loslösung, eines unbefleckten Traums, der im Sonnenschein gedeiht. Die Verzweiflung stellt einen Paroxysmus der Individuation dar, eine schmerzende und eigentümliche Verinnerlichung auf den Höhen, ein Alleinsein des Menschen in der Welt. Alle Zustande, welche aus dem Abbruch der normalen Beziehung zum Leben erwachsen und dich zu den Hohen individueller Einsamkeit emporführen, verstärken den Individuationsprozess und treiben ihn zum Paroxysmus. Des Menschen Gnade führt nicht zum Paroxysmus der Individuation, sondern zum harmonischen Fühlen naiver Erfüllung, wobei das Wesen niemals vom Gefühl der Einsamkeit und der Verlassenheit befallen wird. Die Gnade lehnt die Einsamkeit auch formal ab, weil die Schlangenbewegungen, durch welche sie sich objektiviert, eine Empfänglichkeit fürs Leben zum Ausdruck bringen, einen aufgeschlossenen Elan, nach den Lockungen und dem Pittoresken des Daseins dürstend. Die Gnade stellt einen Zustand der Illusion dar, in dem das Leben seine Antinomien und seine dämonische Dialektik verneint und transzendiert, in dem die Widersprüche, das Irreparable, die Fatalität und das Unheilbare vorübergehend in einer Art sublimierten Lebens verströmen. Es gibt viel Sublimation in der Gnade, viel luftige Lauterkeit, welche aber niemals die tiefen Läuterungen auf den Höhen erreichen, wo das Erhabene verwirklicht wird. Die alltäglichen Erfahrungen und die gemeinen Formen des Erlebens führen das Leben nie bis hinauf zum absoluten Wahnsinn von paroxystischer Spannung oder zum inneren Wirbel, wie sie auch keine Entledigung von der Last, keine zeitweilige Überwindung der Schwerkraft bewirken, die bisweilen ein Symbol des Todes sein konnte. Die Gnade ist eine Erlösung von der Bürde, eine Entbindung vom Druck der unterirdischen Anziehungskräfte, ein Entrinnen aus den bestialischen Klauen dämonischer Urtriebe und den negativen Neigungen des Lebens. Die Transzendierung der Negativität ist ein Wesensmerkmal des anmutigen Lebensgefühls. Es ist nicht verwunderlich, dass in einem derartigen Gefühl das Leben strahlender, lichtdurchfluteter und glanzumwobener erscheint. Denn indem das Leben Negativität und Dämonik durch Harmonie der Formen und wogende Leichtigkeit überwindet, erreicht es eine wohltuende Harmonie eher als auf den verschlungenen Pfaden des Glaubens, wo sie sich erst nach komplexen Widersprüchen und Aufwallungen ergibt. Wie verschieden die Welt doch ist, wenn man bedenkt, dass neben der Gnade eine immerwährende Angst hervorbrechen kann, die manchen bis zur Erschöpfung peinigt. Wer die Angst vor allem, die Furcht vor der Welt, die universale Bangigkeit, die absolute Unruhe, die Qual eines jeden Augenblicks des Lebens nicht erfahren hat, wird niemals verstehen, was das Zappeln der Materie, die Raserei des Fleisches und der Todeswahnsinn bedeuten. Wen anmutiges Lebensgefühl durchdringt, kann die Pein höchster Unruhe, die nur einem krankhaften Grunde entspringt, nicht gewahren und nicht begreifen. Alles Tiefe kann in dieser Welt nur dem Siechtum entsprießen. Was nicht dem Siechtum entspringt, hat nur ästhetischen, formalen Wert. Dahinsiechen bedeutet, ob man will oder nicht, auf Höhen leben. Aber die Höhen deuten nicht unbedingt auf Gipfel hin, sondern auch auf Schluchten und Abgrunde. Auf den Höhen der Verzweiflung leben heißt, sich in den furchtbarsten Abgründen walzen. Es gibt nur abgründige Höhen, denn von den wahren kann man jederzeit abstürzen. Und nur durch solche Stürze erreicht man die Höhen. Die Gnade stellt einen Zustand der Zufriedenheit und bisweilen gar der Beseligung dar. Weder tiefe Abgründe noch große Schmerzen. Weshalb sind Weiber glücklicher als Männer? Weil bei ihnen Anmut und Naivität unvergleichlich häufiger auftreten als bei Männern. Gewiss bleiben auch sie nicht von Krankheiten und Unzufriedenheiten verschont; hier geht es aber um das vorherrschende Gefühl. Die naive Anmut der Weiber versetzt sie in einen Zustand oberflächlichen Gleichgewichtes, der niemals zu aufzehrenden Tragödien oder gefährlichen Spannungen führen kann. Die Frau riskiert auf geistiger Ebene überhaupt nichts, weil bei ihr der Dualismus zwischen Geist und Leben eine viel geringere antinomische Intensität erreicht als beim Manne. Das anmutige Lebensgefühl führt nicht zu metaphysischen Offenbarungen, zur Schau der Wesenheiten, zur Perspektive der letzten Augenblicke, wenn du lebst, als lebtest du nicht mehr. Die Frau ist teuflisch verführender Schein. Je mehr du an sie denkst, desto weniger verstehst du sie. Es ist dem Vorgang analog, der dich zum Schweigen bringt, wenn du langer über das grundlegende Wesen der Welt grübelst. Aber während du angesichts einer unergründlichen Unendlichkeit erstarrst, scheint dir die Frau ein Rätsel zu sein, obgleich sie im Grunde nur verblendender Vorwand ist. Neben der Erfüllung geschlechtlicher Bedürfnisse scheint mir der einzige Sinn des Weibes in der Welt darin zu bestehen, dass es dem Manne Gelegenheit gibt, dem marternden Druck des Geistes zeitweise zu entfliehen. Denn die Frau kann eine zeitweilige Rettung für jene sein, die auf Höhen leben: weil sie im Leben kaum zersetzt ist, bedeutet der Verkehr mit ihr eine Rückkehr zu den naiven und unbewussten Wonnen des Lebens, zur leichten Immaterialität der Anmut, welche zwar nicht die Welt, aber die Weiber erlöst.
*
Wie kann man denn noch Ideale hegen, wenn es hienieden Blinde, Taube oder Tolle gibt? Wie kann ich mich des Lichtes erfreuen, das der Andere nicht sieht, oder des Tons, den er nicht hört? Ich fühle mich für die Finsternis aller verantwortlich und komme mir wie ein Entführer des Lichtes vor. Haben wir nicht den Blinden das Licht und den Tauben den Ton entwunden? ist unsere Luzidität nicht für die Umnachtung der Wahnsinnigen verantwortlich? Ich weiß nicht warum, aber wenn ich an derartige Dinge denke, verliere ich Mut und Willen; alles Denken dünkt mich sinnlos und jegliches Mitleiden nichtig. Denn ich fühle mich nicht dermaßen normal und mittelmäßig, als dass ich jemanden bemitleiden konnte. Man muss außerhalb der Gefahr leben, am einen andern zu bemitleiden. Mitgefühl ist ein Zeichen von Oberflächlichkeit. Denn entweder da zerbirst angesichts des unheilbaren Jammers, der gebrochenen Schicksale, oder du verstummst für alle Zeit. Mitleid und Trost sind nicht nur unwirksam, sondern auch beleidigend. Und wie sollte man einen andern bemitleiden, wenn man selbst unendlich leidet? Mitleid ist ein unverbindliches Gefühl. Deshalb findet man es bei so vielen. In dieser Welt ist noch niemand am Leiden des Andern gestorben. Und jener, der gesagt hat, dass er für uns sterbe, ist nicht gestorben, sondern getötet worden.
76-79
Ironie und Selbstironie *
Wenn du alles frenetisch verneint und mit allen Daseinsformen radikal gebrochen hast, wenn nichts dem Trieb zur und dem Exzess von Negativität standzuhalten vermochte, an wen dich noch klammern außer an dich selbst, über wen noch lachen oder weinen außer über dich selbst? Nachdem die ganze Welt für dich versunken ist, versinkst auch du endgültig. Die Grenzenlosigkeit der Ironie löst alle Inhalte des Lebens auf. Ich meine nicht die elegante, intelligente und feine Ironie, die einem Überlegenheitsgefühl oder leichtfertiger Überheblichkeit entspringt, jene Ironie, durch die einige Menschen ihre Distanz zur Welt auf emphatische Weise kundtun, sondern die tragische, die unendlich bittere Ironie, die Ironie der Verzweiflung. Die einzig wahre Ironie ist die, welche eine Träne oder eine Verkrampfung, wenn nicht gar ein groteskes und verbrecherisches Grinsen ersetzt. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen der Ironie der Menschen, die gelitten haben, und der Ironie der Gecken und Trägen. Denn bei den ersteren deutet sie auf die Unfähigkeit der naiven Teilnahme am Leben hin, die mit dem Gefühl des endgültigen Verlustes der Lebenswerte einhergeht, während
sich diese Unfähigkeit bei den Bequemen nicht schmerzhaft im Bewusstsein widerspiegelt, weil das Gefühl eines unwiederbringlichen Verlustes fehlt. Die Ironie kündet von einer Inneren Verkrampfung, von einer Vertiefung der Furchen, einem Mangel an Spontaneität und Liebe, an Einssein und menschlichem Verständnis! Sie ist eine verschleierte Verachtung, eine Verklärung der Wirklichkeit und mancher Schwäche. Die Ironie verachtet die naive und spontane Gebärde, weil sich der ironische Zustand jenseits des Hintergründigen und Naiven befindet. In der Ironie liegt indessen viel Neid auf den Naiven. Der Ironiker, wegen seiner ungeheuren Vermessenheit unfähig, der Einfalt seine Bewunderung zu zollen, beneidet, vergiftet, verachtet und verkrampft sich. Aus diesem Grunde scheint mir die bittere, tragische und agonale Ironie viel echter zu sein als die lächelnde, die einem leichtfertigen Skeptizismus von verschwommener und mehrdeutiger Heiterkeit entspringt, der aber Anspruch auf Lichtheit und Wohlwollen erhebt. Wie bezeichnend der Umstand ist, dass man in der Selbstironie nur der tragischen Form begegnet, dass der Ironiker in diesem Falle ein Sterbender ist! Selbstironie kann man nicht durch Lächeln erlangen, sondern nur durch Seufzer, selbst wenn diese vollends erstickt sein sollten Denn die Selbstironie ist ein Ausdruck der Verzweiflung. Wenn du die Welt verlierst, so bist auch du verloren. Und dann begleitet ein finsteres, giftiges und grausiges Lachen alle deine Gebärden wie eine schreckliche Maske, zerstört alle beschwingenden Illusionen, und auf den Trümmern alles naiven, sanften und tröstlichen Lächelns erscheint das agonale Lächeln, verkrampfter als die primitiven Masken, aber endgültiger als die ägyptischen.
114-115
Nicht mehr Mensch sein
Ich bin immer überzeugter, dass der Mensch ein unglückliches Tier ist: in der Welt verlassen, genötigt, eine eigene, der Natur vor ihm unbekannte Lebensweise zu finden. Infolge der sogenannten Freiheit leider er mehr als unter der unbarmherzigsten Knechtschaft der Natur. Und deshalb nimmt es mich auch nicht wunder, dass der Mensch dahin kommen kann, eine pflanze oder gar irgendein Unkraut zu beneiden. Wie ein Gewächs leben, angewurzelt heranwachsen wollen, unter der Sonne in vollendeter Bewusstlosigkeit erblühend und verwelkend, ein ein intimer Teil der Fruchtbarkeit der Erde, ein intimer Teil der Fruchtbarkeit der Erde, ein anonymer Ausdruck des Lebensflusses sein wollen bedeutet, am Sinn des Leben verzweifeln. Und weshalb nicht mit einer Blume tauschen?
Ich weiss, was es heisst, Mensch zu sein, Idealen nachzustreben und in der Geschichte zu schmachten. Was kann ich noch von derartigen Realitäten erwarten? Es ist gewiss etwas Besonderes, Mensch zu sein: man erleidet eine der grimmigsten Tragödien, ein beinahe kolossales Drama, denn Mensch sein bedeutet, in einer völlig neuartigen, komplizierteren und erschütternderen Daseinsordnung als der natürlichen leben. Je tiefer man ins unbeseelte Naturreich hinabsteigt, desto mehr lässt die Wucht der Dramatik nach, bis sie sich ganz und gar auflöst. Der Mensch neigt immer mehr dazu, sich das Monopol für Drama und Leiden anzueignen. Deswegen ist die Erlösung für ihn ein so brennendes und unlösbares Problem. Ich kann mich nicht brüsten, Mensch zu sein, weil ich dieses Phänomen bis auf seinen Urgrund durchlebt habe. Nur jene, welche dies nicht mit glühender Intensität erfahren haben, können sich rühmen, Menschen zu sein, weil sie nur erst dazu neigen, es zu werden. So betrachtet, ist ihre Begeisterung selbstverständlich. Nun gibt es freilich unter den Menschen gar manche, die sich nicht gerade weit über die animalische oder vegetabilische Lebensform zu erheben vermochten. Weshalb es naturgemäss ist, dass sie sich nach dem Menschentum sehnen und es anbeten. Aber jene, die wissen, wie es darum bewandt ist, trachten nach allem, nur danach nicht, Mensch zu sein. Wenn es möglich wäre, würde ich mich jeden Tag in eine besondere Form tierischen oder pflanzlichen Lebens verwandeln. Ich wollte nacheinander alle Formen von Blumen und Blüten annehmen; Kräuter, Dornen und Rosen sein oder ein tropischer Baum mit oder eine verschlungenen Zwegen, ein wogenumbrandetes, wogenumbrandetes Meeresgewachs oder eine von Winden gepeitschte Gebirgspflanze; ein Vogel mit wohltönendem Gesang oder ein . krächzender und kreischender Raubvogel, Zug- oder Standvogel, Walduntier oder Haustier. Alle Arten in wilder und bewusstloser Raserei durchleben, alle Schichten der Natur durchlaufen, die Gestalt mit der Unbefangenheit naiver Anmut wechseln, ohne Posen, wie ein natürlicher Vorgang. Wie würde ich durch alle Horste und Höhlen umherirren, durch Berg- und Meereseinsamkeiten, Hügel und Felder. Nur dieses kosmische, im Wesenskern des Lebens, in seiner organischen Innigkeit erlebte Abenteuer, den Arabesken der Lebensformen und der pittoresken Naivität der Pflanzenwelt folgend, könnte mich auf den Geschmack bringen, wieder Mensch zu werden. Denn wenn der Unterschied zwischen Mensch und Tier darin besteht, dass das Tier nur Tier, während der Mensch auch Unmensch, somit etwas Anderes sein kann als er selbst – dann bin ich Unmensch.
87-88

Magie und Fatalität
Es fällt mir schwer, mir die Freude der mit primitiver Sensibilität Begabten vorzustellen, dieser Menschen, die fühlen, alles bewältigen zu können, denen kein Widerstand zu gross und kein Hindernis unüberwindlich scheint. Die Magie setzt ein Einssein mit dem Leben voraus, so dass jede subjektive Äusserung ein Ausdruck des Pulsschlags alles Lebens ist. Sie birgt die gesamte Fülle der Integration in den Lebensstrom in sich, die gesamte überschwenglichkeit der Betätigung im Sinne und in Richtung der Immanenz dieses Lebens. Ursprüngliches Empfindungsvermögen kann nur zur Freude führen, . weil es für sie das Unheilbare, das Unlösbare und das Unabwendbare als Bestandteile des inneren Wesensgefüges nicht gibt.fühlen, dass du alles kannst, dass das Absolute in deiner Macht steht, dass dein Überschwang der Überschwang dieser Welt ist, dass der universale Rhythmus in dir frenetisch und stürmisch schlägt, dass du die Welt bist, dass dein Dasein nur in dem Masse vorstellbar ist, als es dich durchströmt, den Sinn der Welt jeden Augenblick im vollendetem Ausdruck vergegenwärtigt finden bedeutet gewiss, eine unfassliche Form der Freude verwirklichen, welche das Monopol der mit primitiver Sensibilität Begnadeten ist. Für die Magie gibt es keine Krankheiten, oder wenn es welche gibt, dann stellt magische Vision sie sich heilbar vor, so dass ihre Unerbittlichkeit verfliegt. Der magische Optimismus betrachtet alles unter dem Gesichtspunkt der Gleichwertigkeit; deshalb ist für ihn jeder Versuch trügerisch, die Krankheit zu individualisieren und spezifisch zu behandeln. Die Magie bestreitet und verneint alle Negativität im Leben, das dämonische ,Wesen in der Dialektik des Lebens. Primitive Sensibilität besitzen bedeutet, nichts von den grossen schmerzvollen Wirklichkeiten verstehen, nichts von dem, was das Leben an Unheilbarem und, Unausweichlichem birgt, an Elend und Tod. Die Illusionen der Magie verneinen das Irreparable der Welt und den Tod als verhängnisvolles und, universales Wirken. Dieses Phänomen ist, subjektiv betrachtet, äusserst wichtig, weil es einen Zustand von Seligkeit und von für den Menschen euphorischer Schwärmerei herbeiführt. Denn der Mensch lebt, als würde er niemals sterben. Das ganze Problem des dem Menschen bevorstehenden Todes- läuft im Grunde auf das subjektive Bewusstsein des Todes hinaus. für jene, dem dieses Bewusstsein fehlt, hat die Tatsache dass er durch den Tod ins Nichts eingeht, überhaupt keine Bedeutung. Dem Tode beständig ins Auge schauen bedeutet, ein Paroxysmus des Bewusstseins erfahren. In der Magie hat das Bewusstsein noch nicht jede Autonomie vom Leben errungen, welche ihr den Charakter einer Zentrifugalkraft verleiht, sondern bewahrt noch ein von Lebenskraft strotzendes Wesen.
Jene sind viel komplizierter, welche das Bewusstsein des Unentrinnbaren haben für welche das Unlösbare, Irreparable und Unheilbare in der Welt wirken, die fühlen, dass alle Mühe vergeblich und Reue unmöglich ist, die verstehen, dass die Schicksalhaftigkeit einen wesentlichen Aspekt der Welt bildet. Denn alle wesentlichen Wirklichkeiten entfalten sich unter dem Zeichen des Unentrinnbaren, das auf der Unfähigkeit des Lebens beruht, seine eigenen immanenten Bedingungen und Grenzen zu überschreiten. Die Magie ist bei belanglosen Dingen wirksam, bei den leichten Aspekten, denen das Wesentliche und Gewaltige abgeht, aber angesichts metaphysischer Realitäten nichtig, wo zumeist Schweigen gefordert wird, dessen die primitive Sensibilität allerdings unfähig ist. Mit dem schürenden Bewusstsein der Unabwendbarkeit, mit der Unmöglichkeit und dem Unvermögen angesichts der gewaltigen Probleme leben, die man nicht aufwerfen kann, ohne ins Dasein dramatisch eingespannt zu sein, bedeutet, das Fragezeichen subjektiv erleben, das über dieser Welt waltet und dessen fragende Schlangenwindung ein Symbol der unerkennbaren und unzugänglichen Unendlichkeit zu sein scheint.
*
Behauptet ihr, dass Verzweiflung und Agonie nur als Vorspiel gültig seien, das Ideal jedoch in ihrer Überwindung bestehe und dass anhaltendes Verharren darin zum Automatismus führe? Sprecht ihr vom Pfad der Freuden als dem alleinseligmachenden und verachtet alle andern? Bezeichnet ihr das Dahinleben in den agonalen Augenblicken als Zustand des Egoismus und empfindet nur die Freude als hochherzig? Ihr schlagt uns die Freude. vor: doch wie sollten wir sie von aussen empfangen? Denn wenn sie nicht aus uns hervorwächst, nicht aus unserem inneren Rhythmus und unseren verborgenen Quellen hervorbricht, bleibt jeder äussere Eingriff steril. Es ist so einfach, jenen die Freude ans Herz zu legen, die sich nicht freuen können! Und wie sollte man sich auch freuen, wenn man allezeit von der Obsession des Wahnsinns bedrückt wird? Bemerken jene, welche die Freude mit übermässiger Gedankenlosigkeit empfehlen, denn nicht, was es heisst, die herannahende Umnachtung zu fürchten, was es bedeutet, jeden Augenblick von der Vorahnung eines entsetzlichen Wahnsinns gegeisselt zu werden? Wie soll man sich freuen, wenn man fühlt, dass man den Verstand zu verlieren droht? Und hinzu kommt noch das Bewusstsein vom Tode, das hartnäckiger und gewiss ist. Was hat es denn für einen Sinn, einem Menschen, der sich in der organischen Unmöglichkeit befindet sich zu freuen, von Freude zu reden? Die Freudigkeit ist ein paradiesischer Zustand, kann aber nur durch eine natürliche Entwicklung erworben werden. Es ist gut möglich, dass wir irgendwann die Dramatik der agonalen Augenblicke abbrechen und in ein Gefilde paradiesischer Heiterkeit und gelassener Freudetrunkenheit eintreten. Bleiben denn des Paradieses Pforten mir ewig verschlossen? Bisher habe ich den Schlüssel zur Seligkeit nicht gefunden, um sie aufzusperren. Und da wir uns nicht freuen können; bleibt uns nur der Weg aller Leiden übrig und eines wahnsinnigen und uferlosen Überschwanges. Wir müssen die: agonalen Momente zum letzten Ausdruck erheben und unser innerliches • Drama. bis zum absoluten Paroxysmus durchleiden. Es verbleibt uns nur noch die äusserste Spannung; nach der nichts als Rauch zu sehen sein wird: denn unser Feuer wird alles verzehrt haben. Die Freude bedarf keiner Rechtfertigung, denn sie ist ein derart lauterer und edler Zustand; dass sich jedes Lob erübrigt. Ihre Rechtfertigung ist Verzweifelten gegenüber sogar sinnlos, weil diese entweder organisch verzweifelt, und die Freude demnach unmöglich ist; oder nicht organisch verzweifelt sind, und ihnen die Freude dann genügend Anreize bietet, um jede Rechtfertigung überflüssig zu machen: Absolute Verzweiflung ist unermesslich komplizierter als absolutes Frohlocken. Vielleicht sind aus diesem Grunde die Pforten des Himmels den Hoffnungslosen allzu eng…
*
Es gibt überhaupt keinen, der im Grunde:seiner Seele nicht ein – noch so blasses und unbestimmtes – Sehnen nach dem Schmerz und der Krankheit empfände, denen er, entronnen ist. Jene, die heftig und unablässig leiden, wünschen zwar zu gesunden, können jedoch nicht. umhin, an ihre Genesung als an einen verhängnisvollen Verlust zu denken. Wenn der Schmerz Teil deines Wesens wird, scheint es unmöglich zu sein, dass seine Überwindung nicht einem Verlust gleichkäme, sowie es auch undenkbar ist, dass dieser kein Bedauern erweckt. Mein Bestes, aber auch den Lebensverlust habe ich dem Leiden zu verdanken. Aus diesem Grunde kann es nicht verdammt, aber auch nicht geliebt werden. Ihm gegenüber wahre ich ein eigentümliches, unbestimmbares, absonderliches und unmerkliches Gefühl, bestrickend wie Zwielicht. Die Seligkeit im Leiden ist reine Täuschung, weil die künstliche Lust am Leiden sich aus dem Bedürfnis ergibt, eine Versöhnung mit der Schicksalhaftigkeit des Schmerzes zu bewirken, um nicht an ihm zugrunde zu gehen. Die letzten Lebensreserven glimmen in diesem trügerischen Beseligtsein auf. Die einzige dem Schmerz erteilte Zustimmung ist die, welche von der Trauer um eine mögliche Heilung ausgedrückt wird. Doch diese Trauer ist derart ungreifbar und verschwommen, dass sie keinem Bewusstsein deutlich werden kann. Alle Schmerzen, die erlöschen, bringen ein Gefühl der Trübung mit sich, als versperrte dir das Eingehen in einen beruhigenden Rhythmus den Weg zu den peinigenden und zugleich berauschenden Gefilden, die du nicht verlassen kannst, ohnezurückzublicken. Zwar hat die Leidseligkeit dir nicht die Schönheit geoffenbart, doch keine Lichter könnten dein Auge noch blenden! Vielleicht deshalb nicht; weil sie flackern und zittern, als ob sie erlöschen wollten? Reizt dich noch immer die Ahnung der Nacht des Leidens?
*
Man kann den Sinn des Lebens aus so vielen Blickwinkeln verneinen, dass ihre Aufzählung zwecklos wäre. Verzweiflung, Unendlichkeit, Tod sind die einleuchtendsten. Es gibt jedoch so viele intime Gründe und Ursachen, die zur völligen Lebensverneinung führen! Denn gegenüber dem Leben gibt es weder Wahrheit noch Unwahrheit, sondern lediglich die spontane Reaktion unseres innersten Wesens.
Subjektivismus? Aber es ist mir doch völlig gleichgültig, dass Andere anders denken. Denn eine subjektive Erfahrung erhebt dich auf die Ebene der Universalität, wie der Augenblick auf die der Ewigkeit. Dir vorzuwerfen, dass die Verzweiflung gänzlich individuell und für andere völlig irrelevant sei, ist genauso absurd, wie wenn man dir sagte, dass das Sterben rein individuell sei und deshalb niemanden verpflichte .. Wie wenig die Menschen die Einsamkeit zu schätzen wissen!
Sobald etwas in der Einsamkeit geschieht, beeilen sie sich, ihre Sterilität zu erklären. Sie legen dem sozialen.Wirken ausschliesslichen Wert bei, weil sie sich dem Wahn hingeben, dass alle dazu beigetragen haben. Alle wollen etwas Wirksames tun, verwirklichen, durch ihre Leistungen überleben, als ob diese nicht zu Staub und Asche zerfielen! Was soll denn aus allem werden? Was könnte anderes werden als das Nichts? Ich bin mit allem unzufrieden. Selbst wenn man mich zum Gott dieser Welt erköre, würde ich sofort zurücktreten, und wenn sich die ganze Welt auf mich beschränkte, wenn ich die Welt wäre, würde ich mich bis zum Verschwinden zerreiben . . . Wie kann ich denn Augenblicke erleben, in denen ich alles zu verstehen glaube?!
Pag. 89-93
Licht und Finsternis
Wie nichtig alle philosophischen und historischen Deutungen der Religionen sind, vermag nur die Verkennung der Bedeutung des Dualismus von Licht und Finsternis in den orientalischen Religionen und in jeder Mystik besser zu veranschaulichen. Diese Auslegungen behaupten, dass die Erhebung des Lichtes und der Finsternis zum Range metaphysischer Prinzipien von der Beobachtung des regelmässigen Wechsels von Tag und Nacht herzuleiten sei, wobei jener ein Lebensprinzip und diese ein Prinzip des Mysteriums und des Todes darstelle. Die Interpretation ist scheinbar äusserst glaubwürdig. Für den nach tieferen Gründen Schürfenden ist sie wie alle äusserlichen Erklärungen völlig unzureichend. Das Problem des Lichtes und der Finsternis ist mit dem Problem der ekstatischen Zustände innig verbunden. Keinem gelingt es, diesem Dualismus einen derart grossen Erklärungswert beizulegen, der die verwickelte und sonderbare Obsession der gleichzeitigen oder aufeinanderfolgenden Knechtung durch die Kräfte des Lichtes und der Finsternis nicht erfahren hat. Die ekstatischen Zustände vermengen die Schatten mit den Funken, setzen blitzartiges Gefunkel mit dem Geheimnis flüchtiger Schatten in einer dramatischen Vision zusammen, bilden eine wahre Stufenleiter von Nuancen zwischen Licht und Dunkel. Indessen ist nicht diese Entfaltung beeindruckend, sondern die Tatsache, dass man von ihnen unterjocht, umgarnt und heimgesucht wird. Den Gipfel der Ekstase erreicht man in der letzten Empfindung, in der man wegen des Lichtes und der Finsternis zu sterben scheint. Es ist sehr merkwürdig, dass alle uns umgebenden Gegenstände, alle Formen, durch welche sich die Welt individualisiert, in der ekstatischen Vision zerrinnen. Es gibt nur noch eine monumentale Projektion von Schatten und Lichtern. Wie diese Auslese und Läuterung vonstatten gehen, ist schwer zu erklären, ebenso schwer wie die Vereinbarkeit von Faszinationskraft, Beherrschungsgewalt mit ihrer Immaterialität. Jeder ekstatischen Exaltation wohnt eine so eigentümliche Dämonie inne! Und wenn in der Verzückung von der Welt nur noch Finsternis und Licht übrigbleiben, wie sollten wir diesen nicht absoluten Charakter zuschreiben? Eine einfache Feststellung der äusseren Aufeinanderfolge dies er beiden Aspekte kann niemals zu einer solchen Absolutheit führen. Die Häufigkeit ekstatischer Zustände im Orient und in der Mystik aller Zeiten kann unsere Vermutung verifizieren. Niemand findet ein Absolutes in der Aussenwelt, sondern nur im Innern. Und die Ekstase, dieser Paroxysmus der lnnerlichkeit, offenbart nur inneres Prangen und inneren Schatten. Im Vergleich zu deren Farbe verlieren Tag und Nacht jede Ausdruckskraft, jeden besonderen Reiz. Die ekstatischen Zustände erreichen eine derartige Wesenhaftigkeit, dass ihr Abstieg in tiefe Abgründe des Daseins den Eindruck von Blendung und metaphysischer Halluzination erweckt. Die Ekstase erfasst nur reine, mithin unkörperliche Wesenheiten. Aber ihre lmmaterialität erregt Schwinel und Obessionen, denen man nur entrinnt, indem man sie in metaphysische Prinzipien umwandelt.
Pag. 99-100
Das übernächtige Tier
Wer sagt, dass der Schlaf der Hoffnung gleiche, hatte eine bewundernswerte Intuition der ungeheuren Bedeutung des Schlafes sowie der nicht geringeren Bedeutung der Schlaflosigkeit. Die Schlaflosigkeit ist eine so grossartige Realität, dass ich mich zur Frage genötigt fühle, oh der Mensch nicht ein übernächtiges Tier sei. Weshalb den Menschen ein rationales Tier nennen, findet man doch bei gewissen Tieren soviel Verstand vor. Es gibt jedoch auf der gesamten Stufe animalischen Lebens kein einziges Tier ausser dem Menschen, welches schlafen wollte und es nicht könnte. Im Schlaf vergisst du das Drama deines Lebens, die Komplikationen und Obsessionen, so dass jedes Erwachen ein neuer Lebensanfang ist, eine neue Hoffnung. Das Leben erhält auf diese Weise eine angenehme Diskontinuität, die den Eindruck einer ununterbrochenen Regeneration, einer fortwährenden Wiedergeburt erweckt. Schlaflosigkeit führt hingegen zu einem Gefühl der Agonie, einem unheilbaren Alpdruck, einer immerwährenden Verzweiflung. Der gesunde Mensch, also ein Tier, betrachtet die Beschäftigung mit der Schlaflosigkeit als selbstgefällig und unernst, weil er nicht weiss, dass es nicht wenige gibt, die ein Vermögen für Schlaf ausgeben würden, die das Bett fürchten und ein ganzes Reich für die Unbewusstheit des Schlafes zu opfern bereit wären, dem sie von erbarmungslosem Wachsein und dem Chaos der Schlaflosigkeit brutal entrissen werden. Es gibt innige Bande zwischen Schlaflosigkeit und Verzweiflung. Ich frage mich, oh es Verzweiflung ohne schlaflose Nächte geben kann, ob ein vollständiger Verlust der Hoffnung ohne Mitwirkung der Insomnie überhaupt möglich ist. Der Unterschied zwischen Hölle und Himmel kann nur dieser sein: im Paradies kann man schlafen, wann man will, in der Hölle niemals. Hat Gott den Menschen nicht dadurch gestraft, daB er ihm den Schlaf nahm und die Erkenntnis auferlegte? Und besteht die fürchterlichste Sühne nicht darin, dass man es in einigen Gefängnissen verbietet sich hinzulegen? Die Irren leiden viel an Schlaflosigkeit; daher die entsetzlichen Depressionen, die sie durchleben, der Lebensüberdruss und der Hang zum Selbstmord. Es ist unmöglich, das Leben zu lieben, wenn man nicht schlafen kann. Und deutet jenes Gefühl des Hinabtauchens, des Versinkens in die Tiefe, des
Herniedergleitens ins Nichts, das in gewissen Augenblicken absoluten Wachseins aufkommt, nicht auf eine Form des Wahnsinns hin? Jene, die sich das Leben nehmen, indem sie sich ins Wasser oder aus dem Fenster stürzen, tun es gewiss aus einem blinden Trieb und wegen der ungeheuren Anziehungskraft der Abgründe. Wen die innere Vision des Eintauchens in tiefe Wasser, die Empfindung eines ungehemmten Versinkens in Meeresschlünde – als wollte er vor dem Lichte fliehen, um am Grunde der Ozeane zu leben – nicht erschütterte, wer in den Lüften keinen innerlichen Taumel fühlte, der kosmische Staubwirbel zieht, wird niemals den Hintergrund der schaurigen Anziehung des Nichts verstehen, das manchen zur höchsten Entsagung antreibt.
*
Ich bin ein sinnleerer Mensch und bedaure es keineswegs, vom Sinn entbunden zu sein. Und-weshalb sollte ich es auch bedauern, wenn mein Chaos nur Chaos gebiert? In mir gibt es auch keinen Willen zur Form oder zum Ideal. Warum denn nicht entfliegen? Ist mein Sehnen nach Flug nicht Daseinsflucht?.
*
In mir ist so viel Verwirrung, dass ich nicht weiss, wie eine Menschenseele sie ertragen kann. Sie finden in mir alles mögliche, absolut alles. Ich bin ein Wesen der Urzeit, das nach der Entstehung der Welt übrigblieb, dessen Elemente noch nicht zusammengefügt sind und in dem das ursprüngliche Wirrwarr rasend und strudelnd spielt. Ich binder absolute Widerspruch, der Paroxysmus der Antinomien und die Grenze der Spannungen; in mir ist alles möglich, denn ich bin der Mensch, der im allerhöchsten Augenblick im Angesichte des absoluten Nichts, in der endgültigen Agonie, im Augenblick des Äussersten lachen wird.
*
Die Zeit lässt sich nur durch das absolute Erleben des Moments aufheben, in dèr vollkommenen Abwendung von allen Reizen des Augenblicks. Dann verwirklichst du die ewige Gegenwart, die nur ein Gefühl der ewigen Gegenwart der Dinge ist. Kümmere dich nicht um Zeit, um Werden und um nichts. Die ewige Gegenwart ist Dasein, weil die Existenz nur durch das volle Erleben der ewigen Gegenwart an Evidenz gewinnt. Die Gegenwart, die subjektiverweise aus der Reihe der Augenblicke herausgerissen wird, ist Werden, Überwindung des Nichts, das nur dort erscheinen kann, wo die Zeitlichkeit dem Dasein wesentlich wird. Denn die Zeitlichkeit führt ein Moment des Nichts ins Werden ein, weil alles, was sich in der Zeit verbraucht, implizite seine Unbeständigkeit beweist. Selig sind jene, die im Augenblick leben, die nur die Glückseligkeit des Augenblicks anstreben und die Verzückung ewiger Gegenwart und immerwährender Aktualität der Dinge. Erreicht man denn in der Liebe nicht die Absolutheit des Moments? Ist die Unbewusstheit der Liebe kein wahres Erleben des Augenblicks? Überwindet die wahre Liebe nicht sogar die Zeitlichkeit? Jene, die nicht mit spontaner Hingebung lieben können, tun es nur aus Traurigkeit und Ängstlichkeit, aber auch wegen des dramatischen Ringens mit der Zeit, aus Unfähigkeit, die Zeit zu überwinden. Ist die Zeit nicht reif, um ihr Krieg zu erklären auf Leben und Tod? Und ist sie nicht unser aller Feind?
*
Die grösste Torheit, die der menschliche Geist hat ausbrüten können, ist die Vorstellung der Erlösung durch Abtötung der Begierden. Warum das Leben bremsen, warum es zerstören für einen derart unfruchtbaren Ertrag wie den vollkommenen Gleichmut, eine Erlösung, die gar nichts frommt? Wie kann man es noch wagen, vom Leben zu reden, wenn man es in sich restlos vernichtet hat? Ich habe mehr Achtung vor einem in der Liebe unglücklichen und verzweifelten Menschen, dessen Wünsche vereitelt worden sind; als vor einem kaltblütigen Weisen von anmassender und abstossender Gleichgültigkeit. Ich kann mir keine widerwärtigere Welt vorstellen als eine Welt von bleichen Weisen. Alle Menschen, die lebendig denken, haben recht, weil es keine durchschlagenden Argumente gegen sie gibt. Und selbst wenn es sie gäbe, könnten sie nur durch Abnutzung zerschmettert werden; Ich kann nicht umhin zu bedauern, dass es noch Menschen gibt:, die nach der Wahrheit suchen. Haben sie noch immer nicht begriffen, dass es die Wahrheit nicht geben kann?
107-109
Die Flucht vom Kreuze
Mir missfallen Propheten und gleichermassen blinde Fanatiker, die niemals an ihrem Glauben und an ihrer Mission gezweifelt haben. Den Wert der Propheten ermesse ich an ihrer Fähigkeit zu zweifeln, an der Häufigkeit der wahren Augenblicke der Pein, der marternden Luzidität. Denn bei grossen Propheten ist der Zweifel verwirrender als bei den anderen Menschen, obgleich die Propheten und Fanatiker nur im Zweifel wirklich menschlich sind. Alles übrige ist Absolutismus, Predigt, Moral und Pädagogik. Sie wollen andere schulmeistern, erlösen, ihnen den, Weg zur Wahrheit aufzeigen, fremde Schicksale irreführen, als ob ihre Wahrheiten besser wären als die der Belehrten. Das Kriterium des Zweifels ist das einzig gültige, um sie von Manikern zu unterscheiden. Zweifeln sie jedoch nicht allzu spät? Jener, der sich für Gottes Sohn hielt, hat nur in den allerletzten Augenblikken gezweifelt. Und der wahre Zweifel Christi ist nicht der vom Berge, sondern der vom Kreuz. Ich bin überzeugt, dass Jesus am Kreuze das Los des anonymsten aller Menschen beneidet hat und dass er, hätte es nur in seiner Macht gestanden, sich in den dunkelsten Winkel der Welt zurückgezogen hätte, wo niemand mehr nach Hoffnung oder Erlösung verlangt haben würde. Und als er mit den römischen Soldaten allein geblieben war, hat er sie gewissslich gebeten, ihn vom Kreuz herabzunehmen, ihm die Nägel herauszuziehn, damit er so weit weg flöhe, dass der Widerhall des menschlichen Leidens ihn nicht mehr erreichen könnte. Nicht dass Jesus schlagartig aufgehört hätte, an seine Botschaft und seine Vorstellungen zu glauben – er war zu erleuchtet, um skeptisch zu sein-, aber der Tod für andere ist viel schwerer zu ertragen als dein eigener, als die völlige Verzehrung deines persönlichen Schicksals. Jesus hat die Kreuzigung auf sich genommen, weil er wusste, dass seine Heilslehre nur durch sein eigenes Opfer triumphieren könne.
So fordern es die Menschen: damit sie an dich glauben, musst du auf alles und zuallerletzt auf dich selbst verzichten. Sie sind böse und verbrecherisch; sie wollen, dass du stirbst, um die Echtheit deines Glaubens unter Beweis zu stellen. Weshalb bewundern sie wohl die Schriften, die einer Verblutung entströmen? Weil diese sie vom Leiden verschonen oder ihnen die Illusion des Leidens vermitteln. Sie wollen Blut oder Tränen hinter den Zeilen sehen, auf dass dein Schicksal angesichts ihrer Mittelmässigkeit und Zufriedenheit einziganrtig und bewunderungswürdig erscheine. Die ganze Bewunderung des Haufens ist voll Sadismus.
Wenn Jesus nicht am Kreuze gestorben wäre, hätte das Christentum nicht triumphiert. Die Menschen zweifeln mit Recht an allem, nur am Tode zweifeln sie nicht. Und der Tod Jesu gab ihnen eben die höchste Gewissheit, die allerhöchste Zuversicht angesichts der Gültigkeit christlicher Prinzipien. Christus hätte wohl der Gefahr der Kreuzigung entrinnen oder den wunderbaren Versuchungen des Teufels erliegen können, welche die Versuchungen des Lebens symbolisch ausdrücken. Wer keinen Pakt mit dem Teufel schliesst, hat keinen Grund zu leben, denn dieser drückt das Wesen des Lebens symbolisch besser aus als Gott. Zu meinem Leidwesen hat mich der Teufel so selten versucht … Aber auch Gott hat mich nicht geliebt. Die Christen haben immer noch nicht verstanden, dass Gott den Menschen ferner ist als diese ihm. Ich stelle mir einen von diesen Menschen, die nichts als verlangen und fordern können, über die Massen angeödeten, ob der Trivialität seiner Schöpfung erbosten, von Erde und Himmel angewiderten Gott vor, der ins Nichts flieht, wie Jesus vom Kreuze …
Was wäre wohl geschehen, wenn die römischen Soldaten die Bitte Jesu erhört, ihn vom Kreuz abgenommen und ihn hätten gehen lassen? Keinesfalls wäre er in eine andere Weltgegend gezogen, um zu predigen, sondern um allein zu sterben, ohne die Bemitleidung der Menschen und ohne ihre Tränen. Selbst wenn Jesus – aus Stolz – die Soldaten nicht um seine Freilassung gebeten hätte, kann ich unmöglich glauben, dass ihn dieser Gedanke nicht verfolgt haben sollte. Jesus hat unbedingt geglaubt, der Sohn Gottes zu sein, aber dies konnte ihn kaum hindern, angesichts des Opfers für andere zu zweifeln oder den Tod zu fürchten. Wenn Jesus während des ganzen Vorgangs der Kreuzigung auch keinen Augenblick daran gezweifelt hat, Gottes Sohn zu sein, so muss er es doch bereut haben. Im Angesichte des Todes hat Jesus bereut, der Sohn Gottes zu sein. Und wenn er den Tod hinnahm, so nur, auf dass seine Botschaft triumphiere.
Es ist gut möglich, dass Jesus viel einfältiger war, als wir ihn uns vorstellen, dass er weniger Zweifel hatte und weniger Reue empfand. Denn er hat nur in den letzten Augenblicken seine göttliche Herkunft bezweifelt und bereut. Wir zweifeln und bereuen so viel, dass sich keiner von uns für den Sohn Gottes halten kann. Deshalb können wir auch nicht mehr heilig sein un an Prediger glauben. Ich verabscheue bei Jesus alles was Moral-predigt, Lehrmeinung und Glaube ist. Hätte er uns bloss in Frieden gelassen und uns nicht mehr mit so vielen Idealen und Glaubenssätzen belästigt. Denn es gibt genügend Menschen die Ideale und Glauben haben. Ich liebe an Jesus die Augenblicke des Zweifelns und der Reue, die wahrhaft tragischen Momente seines Lebens, welche mich aber weder die interessantesten noch die schmerzvollsten dünken. Denn mässe man das Leid, wie viele hätten nicht das Recht, sich vor ihm als Gottes Söhne zu betrachten! Es könnte sein, dass nicht alle Gottessöhne am Kreuz, an einem geometrischen und vertikalen Tode sterben!
118-120
Bron: E.M., Cioran, Werke, Frankfurt am Main 2008 (Suhrkamp) – uit: Auf den Gipfeln der Verzweiflung (vertaling: Ferdinand Leopold)

Die neuen Götter
Wer sich für die Aufeinanderfolge unreduzierbarer Ideen und Glaubenslehren interessiert sollte dem Schauspiel, das die ersten Jahrhunderte unseres Zeitalters bieten, Beachtung schenken: er würde da das Modell aller Konflikte finden, denen man, in gemässigter Form, in jedwedem Moment der Geschichte begegnet. Das ist nicht verwunderlich, handelt es sich doch um die Epoche, in der am meisten gehasst wurde. Und zwar geht das auf das Konto der hitzigen, unduldsamen Christen, die von vornherein die Kunst der Verabscheuung meisterhaft beherrschten, während die Heiden sich nur noch der Geringschätzung zu bedienen wussten. Die Aggressivität ist ein Zug, den neue Männer und neue Götter miteinander gemein haben.
Wenn ein Ausbund von Freundlichkeit, der keine Gehässigkeit kennt, sie dennoch kennenlernen oder wenigstens wissen möchte, was sie wert ist, wäre es das einfachste für ihn, ein paar Kirchenschriftsteller zu lesen; er bräuchte nur mit dem alle überragenden Tertullian zu beginnen und mit dem, sagen wir, Heiligen Gregor von Nazianz zu enden, diesem giftigen und doch faden Autor, dessen Rede gegen Julian Apostata einen veranlassen könnte, sofort zum Heidentum überzutreten. Darin wird dem Kaiser keine einzige gute Eigenschaft zuerkannt; mit unverhohlene; Genugtuung wird sein Heldentod im Krieg gegen die Perser bestritten, wo er angeblich von »einem Barbaren« getötet wurde, »der als Spassmacher diente und dem Heer folgte, um durch seine Scherze und Witze die Soldaten von der Mühsal des Krieges abzulenken«. Keine Spur von Eleganz, nicht die geringste Bemühung, sich einen solchen Gegner würdig zu erweisen. Was im Falle des Heiligen um so unverzeihlicher ist, als er Julian in Athen in jungen Jahren gekannt hatte, zu einer Zeit, da beide dort die philosophischen Schulen besuchten.
Nichts ist so widerlich wie der Ton jener Leute, die eine scheinbar verlorene, in Wirklichkeit aber siegreiche Sache verteidigen und beim Gedanken an den Triumph ihre Freude nicht verbergen und sich nicht enthalten können, alle ihre eigenen Befürchtungen in Drohungen zu verwandeln. Wenn Tertulian höhnisch und bebend das Jüngste Gericht, das grösste Schauspiel, wie er es nennt, beschreibt, stellt er sich sein eigenes Gelächter beim Anblick der vielen Monarchen und Götter vor, die »im tiefsten Abgrund schreckliche Seufzer ausstossen … «. Die Eindringlichkeit, mit der er die Heiden daran erinnerte, dass sie und ihre Idole verloren seien, empörte sogar die nachsichtigsten Geister. Die christliche Apologetik, eine Reihe als Traktate getarnter Schmähschriften, stellt einen Höhepunkt der Gehässigkeit dar.
Nur im Schatten verbrauchter Gottheiten kann man frei atmen. Je mehr man sich davon überzeugt, um so häufiger sagt man sich voller Schrecken, dass man, wenn man während der Entstehung des Christentums gelebt hätte, vielleicht seinem Zauber erlegen wäre. Die Anfänge einer Religion ( ebenso wie die Anfänge von allem, was es auch sei) sind immer verdächtig. Ihnen allein wohnt jedoch eine gewisse Wirklichkeit inne, sie allein sind wahr; wahr und schauderhaft. Man nimmt nicht ungestraft an der Einsetzung eines Gottes teil, welcher er auch sein und woher er auch auftauchen möge. Diese Unzuträglichkeit ist nichts Neues: Prometheus kündigte sie schon an, als ein Opfer des Zeus und der neuen Clique des Olymps.
Viel mehr als durch die Aussicht auf das Heil liessen sich die Christen durch den Hass gegen die antike Welt zur Zerstörungswut hinreissen. Da sie zum grössten Teil aus der Fremde kamen, ist ihr Wüten gegen Rom erklärlich. Aber an welcher frenetischen Begeisterung durfte der Einheimische teilnehmen, wenn er sich bekehrte? lm Gegensatz zu den anderen blieb ihm nur eine Möglichkeit: sich selbst zu hassen. Ohne diese Umleitung des Hasses, die anfangs ungewöhnlich erschien und später ansteckend wirkte, wäre das Christentum eine blosse, auf den Zuspruch von Fremden beschränkte Sekte geblieben, die nichts anderes bewirkt hätte, als ungestraft und unbesorgt die ehemaligen Götter gegen eine angenagelte Leiche auszutauschen.
Jemand, der wissen möchte, wie er auf den Gesinnungswandel Konstantins reagiert hätte, möge sich in die Lage eines auf sein Heidentum stolzen Traditionalisten versetzen: wie sollte er dem Kreuz zustimmen, wie sollte er das Symbol eines schimpflichen Todes auf den römischen Standarten dulden? Man fand sich dennoch damit ab, und man kann sich schwerlich vorstellen, wieviel innere Kapitulationen zu dieser Entsagung geführt haben, die bald zu einem allgemeinen Verzicht wurde. Wenn man diese Entsagung vom moralischen Gesichtspunkt aus betrachtet, kann man sie als die Krönung einer Krise ansehen und ihr so das Statut oder die Entschuldigung einer Konversion zu billigen; sobald man sie aber nur unter dem politischen Gesichtswinkel sieht, erscheint sie. als Verrat. Die Götter aufgeben, die Rom hatten entstehen lassen; hiess Rom selber aufgeben, um sich diesem »neuen Geschlecht gestern geborener Menschen ohne Vaterland und ohne Überlieferungen« .anzuschliessen, »die sich gegen alle religiösen und zivilen Institutionen verbündet hatten, von der Justiz verfolgt wurden, allgemein als ehrlos berüchtigt waren, aber sich der allgemeinen Verabscheuung rühmten«. — Das Pamphlet von Celsus stammt aus dem Jahre 178. Fast zwei Jahrhunderte später sollte Julian seinerseits schreiben: “Wenn es unter der Herrschaft des Tiberius oder des Claudius nur einen einzigen vornehmen Geist gegeben hat, der sich zu christlichen Ideen bekehrte, so will ich als der grösste Lügner gelten.«
Dieses »neue Menschengeschlecht« sollte sich lange abmühen müssen, bevor es die Feinsinnigen für sich gewann. Wie sollte man sich auch diesen Unbekannten anvertrauen, die aus den untersten Schichten des Volkes kamen und deren Gesten alle nur Verachtung verdienten? Das war es ja eben: wie sollte man den Gott jener, die man verachtete, akzeptieren, zumal er erst kürzlich gemacht worden war? Das Alter allein gewährleistete die Gültigkeit der Götter, man duldete sie alle, vorausgesetzt, dass sie nicht neueren Datums waren. Was man in diesem Fall besonders ärgerlich fand, war die absolute Neuheit des Sohnes: ein Zeitgenosse, ein Emporkömmling … Gerade diese widerliche Person, die von keinem Weisen vorhergesehen oder angedeutet worden war, »schockierte« am heftigsten. Sein Erscheinen war ein Skandal; man brauchte vier Jahrhunderte, um sich daran zu gewöhnen. Da der Vater, ein alter Bekannter, zugelassen war, beschränkten die Christen sich aus taktischen Gründen auf ihn und beriefen sich auf ihn: waren nicht die Bücher, die ihn priesen und deren Geist die Evangelien verewigten, laut Tertullian, mehrere Jahrhunderte älter als die Tempel, Orakel und Götter der Heiden? Einmal in Schwung, behauptet der Apologet sogar, Moses sei einige Jahrtausende älter als die Ruine von Troja. Solche Phantastereien sollten die Wirkung dämpfen, die Bemerkungen wie diese von Celsus ausüben konnten: »Schliesslich haben die Juden vor langen Jahrhunderten eine Nation gebildet, haben Gesetze zu ihrem eigenen Gebrauch begründet, an denen sie noch heute festhalten. Ihre Religion ist, was sie auch wert sein mag und was immer man darüber sagen mag, die Religion ihrer Vorfahren Indem sie ihr treu bleiben, tun sie nichts anderes als andere Menschen, die die Bräuche ihres Landes bewahren.«
Dem Vorurteil des Alters der Götter huldigen hiess, implizite die einheimischen Götter als einzig legitime anerkennen. Die Christen wollten sich aus Berechnung wohl diesem Vorurteil als solchem beugen, aber sie konnten, wenn sie sich nicht selbst zerstören wollten, nicht weitergehen, geschweige denn dieses Vorurteil mit allen seinen Folgen übernehmen. Für einen Origenes waren die Volksgötter Götzen, Überbleibsel des Polytheismus; der heilige Paulus hatte sie schon zu Dämonen herabgewürdigt. Das Judentum hielt sie alle für trügerisch, ausser einem, seinem eigenen. »Ihr einziger Fehler«, sagt Julian von den Juden, »ist, dass sie bei dem Bemühen, ihrem Gott zu genügen, nicht gleichzeitig auch den anderen dienen.« Er lobt sie jedoch, weil sie die Mode auf religiösem Gebiet nicht mitmachen. »Ich meide die Neuerung auf allen Gebieten, besonders aber im Hinblick auf die Götter« – ist ein Geständnis, das ihn in Verruf brachte und auf das man sich beruft, um ihn als »reaktionär« abzustempeln. Aber welchen »Fortschritt« sollte das Christentum in bezug auf das Heidentum wohl darstellen? Es gibt keinen »qualitativen Sprung« von einem Gott zum anderen oder von einer Kultur zur anderen. Ebensowenig wie von einer Sprache zur anderen. Wer würde es wagen, die Überlegenheit christlicher Schriftsteller über heidnische zu verkünden? Selbst was die Propheten betrifft, die doch einen anderen Atem und einen anderen Stil hatten als die Kirchenväter, so vertraut der Heilige Hieronymus uns an, wie ihm davor graute, sie zu lesen, nachdem er sich wieder mit Cicero und Plautus beschäftigt hatte. Der »Fortschritt« wurde damals von diesen unlesbaren Vätern verkörpert: sich von ihnen abwenden, hiess das, zur »Reaktion« überlaufen? Julian hatte ganz recht, ihnen Homer, Thukydides oder Platon vorzuziehen. Die Verordnung, in der er den christlichen Professoren verbot, die griechischen Autoren zu erläutern, ist heftig kritisiert worden, und zwar nicht nur von seinen Gegnern, sondern auch von allen seinen Bewunderern, zu allen Zeiten. Ohne ihn rechtfertigen zu wollen, kann man doch nicht umhin, ihn zu verstehen. Er hatte es mit Fanatikern zu tun; um sich Achtung zu verschaffen, musste er von Zeit zu Zeit übertreiben, wie sie, ihnen gegenüber irgendeinen Unsinn verzapfen, sonst hätten sie ihn verachtet und für einen Amateur gehalten. Er verlangte also von diesen » Unterrichtenden«, es den Schriftstellern, die sie erläuterten, gleichzutun und deren Meinung über die Götter zu teilen. »Aber wenn sie glauben, dass diese Autoren sich im wichtigsten Punkt geirrt haben, sollen sie in die Kirchen der Galiläer gehen und Matthäus und Lukas kommentieren!”
Je mehr Götter man anerkannte, um so mehr diente man, in den Augen der Alten der Gottheit von der die Götter nur Aspekte, nur verschiedene Seiten waren. Die Beschränkung der Zahl der Götter war eine Ruchlosigkeit; die Abschaffung aller zugunsten eines einzigen war ein Verbrechen. Dieses Verbrechens machten die Christen sich schuldig. Ironie war ihnen gegenüber nicht mehr angebracht: das Übel, das sie verbreiteten, hatte zu weite Gebiete erobert. Aus der Unmöglichkeit, sie mit Gelassenheit zu behandeln, war alle Bitterkeit Julians zu erklären.
Der Polytheismus wird der Mannigfaltigkeit unserer Neigungen und Impulse, denen er eine Betätigungs- und Ausdrucksmöglichkeit bietet, besser gerecht, so dass jede einzelne uns innewohnende Tendenz ihrer Natur entsprechend dem Gott zustreben kann, der ihr gerade passt. Was soll man aber mit einem einzigen Gott anfangen? Wie soll man ihn auffassen, wie ihn gebrauchen? Wenn er gegenwärtig ist, lebt man immer unter Druck. Der Monotheismus unterdrückt unsere Sensibilität, er ergründet uns, indem er uns einengt; ein System von Nötigungen, das uns eine innere Dimension auf Kosten der Entfaltung unserer Kräfte verleiht; er verkorkst uns. Wir waren mit mehreren Göttern sicherlich normaler, als wir es mit einem einzigen sind. Wenn die Gesundheit ein Kriterium ist, welch ein Rückschritt ist dann der Monotheismus!
Unter der Herrschaft mehrerer Götter verteilt sich die Inbrunst; wenn sie sich auf einen einzigen richtet, konzentriert und überschlägt sie sich und verwandelt sich schliesslich in Aggressivität, in Glauben. Die Energie wird nicht mehr zerstreut, sondern ganz in ein und dieselbe Richtung gelenkt. Bemerkenswert war heim Heidentum, dass man dort keinen radikalen Unterschied zwischen »glauben« und »nicht glauben« machte, zwischen »einen Glauben haben« oder »keinen Glauben haben«. Der Glauben ist übrigens eine christliche Erfindung; er setzt ein und dieselbe Gleichgewichtsstörung beim Menschen und bei Gott voraus, die von einem ebenso dramatischen wie wirren Dialog hingerissen sind. Daher der wütende Charakter der neuen Religion. Die vorhergehende, viel humanere Religion liess einem die Freiheit, den Gott zu wählen den man wollte, da sie einem keinen aufdrängte, war es Sache jedes einzelnen diese , diesem oder jenem zuzuneigen. Je wandelbarer man war, um so mehr hatte man das Bedürfnis, die Götter zu wechseln, von einem zum anderen überzugehen, wobei man ganz sicher sein konnte, sie im Laufe eines Menschenlebens alle einmal zu lieben. Sie waren überdies bescheiden, sie verlangten nur Respekt: man grüsste sie, man kniete nicht vor ihnen nieder. Sie waren ideale Götter für einen, dessen Widersprüche weder gelöst waren noch gelöst werden konnten, für den hin- und hergerissenen, unbefriedigten Geist: welch ein Glück für ihn, auf seinen Irrwegen sie alle ausprobieren zu können und beinahe sicher zu sein, gerade auf den zu stossen, dessen er am dringendsten bedurfte. Nach dem Triumph des Christentums wurde die Freiheit, sich ungehindert zwischen ihnen zu bewegen und nach Belieben einen auszuwählen, etwas Undenkbares. Ihr Zusammenwohnen, ihre bewundernswerte Promiskuität war vorbei. Hätte eindes Heidentums milder, aber noch nicht überdrüssiger Ästhet sich der neuen Religion angeschlossen, wenn er geahnt hätte, dass sie sich über so viele Jahrhunderte ausbreiten würde? Hätte er die zur Herrschaft der auswechselbaren Idole gehörende Phantasie gegen einen Kult eingetauscht, dessen Gott sich einer so erschreckenden Langlebigkeit erfreuen sollte?
Scheinbar hat der Mensch die Götter aus einem Schutzbedürfnis heraus ersonnen; in Wirklichkeit aber aus Lust am Leiden. Solange er glaubte, dass es eine Menge davon gebe, hatte er sich einen Spielraum, Ausfluchtsmöglichkeiten zugebilligt; als er sich dann auf einen einzigen Gott beschränkte, mutete er sich zusätzliche Fesseln und Ängste zu. Nur konnte ein sich bis zur Lasterhaftigkeit liebendes und hassendes Tier sich kaum den Luxus einer so tiefen Versklavung leisten. Welche Grausamkeit gegenüber uns selbst war es, uns mit dem grossen Phantom zu verbünden und unser Los an das seine zu ketten! Der einzige Gott macht das Leben unausstehlich.
Das Christentum hat sich der juristischen Strenge der Römer und der philosophischen Akrobatik der Griechen nicht bedient, um den Geist zu befreien, sondern um ihn zu fesseln. Indem es ihn fesselte, hat es ihn gezwungen, sich zu ergründen, sich in sich selbst zu vertiefen. Die Dogmen halten ihn gefangen, setzen ihm äussere Grenzen, die er um keinen Preis überschreiten darf; gleichzeitig lassen sie ihm die Freiheit, sein eigenes Universum zu durchstreifen, seine eigenen Wahnvorstellungen zu erforschen, und, um der Tyrannei der lehrmässigen Gewissheiten zu entgehen, das Sein oder dessen negatives Äquivalent – am äussersten Extrem jeder Empfindung zu suchen. Als Abenteuer eines gefesselten Geistes kommt die Ekstase notwendigerweise häufiger bei einer autoritären Religion vor als bei einer liberalen Religion; sie ist also ein Sprung in die Intimität, die Zuflucht zu den Tiefen, die Flucht zu sich selbst.
Da wir so lange schon kein anderes Refugium als Gott gehabt haben, haben wir uns so tief in ihn hineinversenkt wie in uns selber (wobei dieses Hineinversenken die einzige wirkliche Leistung ist, die wir in zweitausend Jahren vollbracht haben), wir haben seine und unsere Abgründe ausgelotet, seine Geheimnisse nacheinander ruiniert und seine Substanz durch den doppelten Angriff des Wissens und Betens erschöpft. Die Alten haben ihre Götter nicht überanstrengt: sie waren zu fein um sie zu übermüden oder ein
Studienobjekt aus ihnen zu machen. Da der unheilvolle Übergang von der Mythologie zur Theologie sich noch nicht vollzogen hatte, wussten sie nichts von jener ewigen Spannung, die sowohl in den Ergüssen der grossen Mystiker als auch in den Banalitäten des Katechismus waltet. Wenn das Hienieden dem Unmöglichen gleichkommt und wir fühlen, dass der Kontakt, der uns mit ihm verbindet, physisch unterbrochen ist, so ist Abhilfe weder im Glauben noch in der Verneinung des Glaubens (zwei Ausdrücke für die gleiche Gebrechlichkeit) zu suchen, sondern in einem heidnischen Dilettantismus, genauer in der Vorstellung, die wir uns davon machen.
Die schwerstwiegende Unzuträglichkeit, der der Christ begegnet, ist die Tatsache, dass er wissentlich nur einem Gott dienen kann, obgleich er die Freiheit hat, sich in der Praxis mehreren zu verschreiben wie im Heiligenkult. Ein heilsames Verfahren, das dem Polytheismus gestattete, trotz allem indirekt fortzudauern, und das verhinderte, dass ein zu reines Christentum eine universelle Schizophrenie herbeiführte. Tertullian möge es nicht verübeln, aber die Seele ist von Natur aus heidnisch. Jeder beliebige Gott, der unmittelbaren, dringenden Forderungen von uns entspricht, stellt für uns einen Zuwachs an Vitalität, einen Auftrieb dar; dem ist nicht so, wenn der Gott uns aufgedrängt wird oder wenn er keiner Notwendigkeit entspricht. Es ist ein Fehler des Heidentums gewesen, zu viele Götter angesammelt und zugelassen zu haben: es ist an seiner Grossmut, an seinem übertrieben grossen Verständnis zugrunde gegangen, der Mangel an Instinkt führte zu seinem Tod. Wenn man zur Überwindung des Ichs, dieser Lepra, nur noch auf
Wahrscheinlichkeiten baut, kann man das Dahindämmern einer in ihren Prinzipien und Praktiken gleichermassen oberflächlichen Religion ohne Dramen, ohne Gewissenskrisen ohne Auslösung von Gewissensbissen nu bedauern. Im Altertum war die Philosophie und nicht die Religion tiefgründig; allein das Christentum ist die Ursache für die “Tiefgründigkeit und alle Arten von Zerrissenheit, die dem modernen Zeitalter innewohnen.
Die Epochen ohne präzisen Glauben (die hellenistische oder unsere) nehmen eine Klassifizierung der Götter vor, lehnen jedoch eine Einteilung in wahr~ und falsche Götter ab. Hingegen ist die Vorstellung, dass sie alle gleich viel wert sein könnten, in Momenten, da die Inbrunst überwiegt, unannehmbar. Das Gebet könnte schwerlich an einen vermutlich wahren Gort gerichtet werden. Es lässt sich kaum zu Spitzfindigkeiten herab und duldet keine Abstufung im Innern des Höchsten: selbst wenn es zweifelt, tut es dies im Namen der Wahrheit. Man fleht nicht eine Nuance an. All das gilt erst seit der monotheistischen Kalamität. Bei der heidnischen Frömmigkeit war das anders. In Octavius von Minucius Felix lässt der Autor, bevor er die christliche Position verteidigt, Cecilius, den Vertreter des Heidentums, sagen: »Wir sehen, wie nationale Götter verehrt werden: in Eleusis Ceres, in Phrygien Cybele; in Epidauros Äskulap; in Chaldäa Belus; in Syrien Astarte; in Tauris Diana, Merkur bei den Galliern und in Rom alle Götter zusammen«. Und in bezug auf den Christengott, dem einzigen, der nicht annehmbar ist, fügt er hinzu: »Woher kommt dieser einzige, einsame, verlassene Gott, den keine freie Nation, kein Königreich kennt … ?«
Nach einer alten römischen Vorschrift durfte niemand neue oder fremde Götter verehren, wenn diese nicht vom Staat, genauer vom Senat, zugelassen worden waren, der Senat allein war befugt, zu entscheiden, welche Götter verdienten, anerkannt oder verworfen zu werden. Der an der Peripherie des Imperiums aufgetauchte, auf nicht einzugestehende Weise nach Rom gelangte christliche Gott sollte sich später bitter dafür rächen, dass er gezwungen gewesen war, sich einzuschleichen.
Man vernichtet eine Kultur nur, indem man ihre Götter vernichtet. Die Christen, die das Imperium nicht direkt anzugreifen wagten, nahmen sich seine Religion vor. Sie haben sich nur verfolgen lassen, um härter gegen sie wüten zu können, um ihre ununterdrückbaren Gelüste, die anderen zu verfluchen, befriedigen zu können. Wie unglücklich wären sie gewesen, wenn man nicht geruht hätte, sie als Opfer anzuerkennen! Am Heidentum missfiel ihnen alles in höchstem Masse, sogar die Toleranz. Gestützt auf ihre Gewissheiten konnten sie weder begreifen, dass man sich nach Art der Heiden mit Wahrscheinlichkeiten begnügte, noch dass man einen Kult mitmachen konnte, dessen Priester, einfache Darstellungsbeamte des Rituals, von niemandem die Fron der Aufrichtigkeit verlangten.
Sobald man sich klar darüber wird, dass das Leben nur erträglich ist, wenn man die Götter wechseln kann, und dass der Monotheismus alle Formen derTyrannei im Keim enthält, hört man auf, sich der Sklaverei der Antike zu erbarmen. Es war besser, Sklave zu sein und die Gottheit verehren zu dürfen, die man verehren wollte, als »frei« zu sein und nur ein Und dieselbe Abart des Göttlichen vor sich zu haben. Die Freiheit ist das Recht auf Verschiedenartigkeit; als Vielheit fordert sie die, Verstreuung des Absoluten, seine Auflösung in einen Staub von Wahrheiten, die alle gleich gerechtfertigt- und alle gleich provisorisch sind. Es gibt in der liberalen Demokratie einen unterschwelligen ( oder wenn man will unbewussten) Polyheismus; umgekehrt ist jedes autoritäre Regime an einem verkappten Monotheismus beteiligt. Merkwürdige Wirkungen der monotheistischen Logik: wurde ein Heide zum Christen, so wurde er auch intolerant. Lieber mit einer Menge verträglicher Götter untergehen, als im Schatten eines Despoten gedeihen! In einer Epoche, in der wir mangels religiöser Konflikte ideologischen Auseinandersetzungen beiwohnen, stellt sich uns die gleiche Frage, die schon die Spätantike beschäftigt hat: »Wie soll man auf so viele Götter um eines einzigen willen verzichten? « – mit der Einschränkung allenfalls, dass das von uns verlangte Opfer auf einer niedrigeren Stufe, auf der Ebene der. Meinungen und nicht mehr der Götter, gebracht werden muss. Sobald eine Gottheit oder eine Doktrin die Oberhoheit beansprucht, ist die Freiheit bedroht. Wenn man der Toleranz den höchsten Wert beimisst, muss jede Einschränkung als ein Verbrechen gelten, angefangen bei den Bekehrungsbemühungen, einem Gebiet, auf dem die Kirche unübertroffen geblieben ist. Und wenn sie die Schwere der Verfolgungen, denen sie ausgesetzt war, übertrieben und die Zahl ihrer Märtyrer in lächerlicher Weise aufgerundet hat, dann darum, weil sie so lange eine unterdrückende Gewalt ausgeübt hat und ihre Schandtaten mit edlen Vorwänden bemänteln musste: verderbliche Lehren unbestraft lassen, war das nicht ihrerseits ein Verrat an all jenen, die sich für sie geopfert hatten? Aus dem Geist der Treue schritt sie also zur Vernichtung der »Verirrten«, und so konnte sie, nachdem sie vier Jahrhunderte lang verfolgt worden war,: selber vierzehn Jahrhunderte Verfolgerin sein. Das ist das Geheimnis das Wunder ihres Fortbestandes. Nie wurden Märtyrer systematischer und beharrlicher gerächt.
Da die Entstehung des Christentums mit der des Imperiums koinzidierte haben gewisse Kirchenväter (Eusebius unter anderen) behauptet, dieses Zusammentreffen habe einen tiefen Sinn: ein Gott – ein Kaiser. In Wirklichkeit war es die Abschaffung der nationalen Grenzen und die Möglichkeit, sich ungehindert innerhalb eines grossen grenzenlosen Staates zu bewegen, was dem Christentum gestattete, überall einzudringen und zu wüten. Ohne diese Leichtigkeit der Verbreitung wäre es eine einfache Dissidenz innerhalb des Judentums geblieben, anstatt eine um sich greifende Religion, ja, was noch schlimmer war, eine aufdringliche Religion zu werden. Alles war ihr gerade recht, um zu werben,. um sich zu behaupten und sich auszubreiten, bis zu: den Bestattungen am helllichten Tage, deren Schauspiel eine wahre Herausforderung sowohl der Heiden als auch der olympischen Götter war. Julian bemerkte, dass laut den Gesetzgebern von einst »in Anbetracht der Tatsache, dass Leben und Tod völlig verschiedene Dinge sind, die mit dem einen oder dem anderen zusammenhängenden Dinge getrennt vollzogen werden müssen«. In ihrem hemmungslosen Bekehrungseifer waren die Christen nicht gewillt, diese Trennung zu beachten: sie kannten die :Brauchbarkeit der Leiche wohl und wussten, welchen Nutzen man daraus ziehen konnte: Das Heidentum hat den Tod nicht vertuscht, es hat sich jedoch gehütet, ihn zur Schau zu stellen. Es war für das Heidentum ein fundamentales Prinzip, dass der.Tod und der helllichte Tag nicht zueinander passen, dass der Tod eine Beleidigung des Lichts ist; er gehörte zur Nacht und den infernalischen Göttern. Die Galiläer haben alles mit Gräbern ausgefüllt, sagte Julian, der Jesus nie anders als den »Toten« nannte. Den wahren Heiden konnte der neue Aberglaube nur als eine Auswertung des Grässlichen erscheinen. Um so mehr mussten sie die Fortschritte bedauern, die er in allen Kreisen machte. Was Celsus nicht kennen konnte, Julian aber genau kannte, waren die »Konjunkturritter« des Christentums, nämlich jene, die unfähig waren, sich der neuen Lehre ganz zu verschreiben und doch bestrebt waren, ihr zu folgen, da sie fürchteten, wenn sie fernblieben, von der “Zukunft” ausgeschlossen zu sein. Sei es aus Opportunismus oder aus Angst vor der Einsamkeit, sie wollten an der Seite jener »gestern geborenen« Menschen gehen, die jedoch bald aufgerufen werden sollten die Rolle der Herren, der Folterer zu spielen.
So legitim Julians Leidenschaft für die toten Götter gewesen sein mag, er hatte keine Aussicht, sie wieder zum Leben zu erwecken. Anstatt dies vergeblich zu versuchen, hätte er sich besser aus Wut mit den Manichäern verbündet und mit ihnen die Kirche unterminiert. So hätte er, sein Ideal opferend, wenigstens seinen Groll gestillt. Welche andere Karte als die der Rache blieb ihm noch? Eine herrliche Zerstörerkarriere lag vor ihm, und er hätte diesen Weg vielleicht beschritten, wenn sein Bewusstsein nicht von der Sehnsucht nach dem Olymp getrübt gewesen wäre. Man schlägt keine Schlachten um einer Sache willen, der man nachtrauert. Allerdings starb er jung: nach kaum zweijähriger Herrschaft; hätte er zehn oder Zwanzig Jahre vor sich gehabt, welchen Dienst hätte er uns dann erweisen können! Er hätte das Christentum wahrscheinlich nicht abgeschafft, aber er hätte es zu grösserer Bescheidenheit genötigt. Wir wären weniger anfechtbar, denn wir hätten nicht gelebt, als ob wir der Mittelpunkt der Welt wären, als ob alles, sogar Gott, um uns kreiste. Die Inkarnation ist die gefährlichste Schmeichelei, die uns zuteil wurde. Sie hat uns ein massloses Statut verliehen, das in keinem Verhältnis zu dem steht, was wir sind. Indem es die menschliche Anekdote zur Würde des kosmischen Dramas erhebt, hat es uns über unsere Bedeutungslosigkeit hinweggetäuscht, hat es uns in die Illusion, in einen krankhaften Optimismus gestürzt, der die Evidenz missachtend, Weg und Apotheose verwechselt. Das bedächtigere Altertum stellte den Menschen an seinen Platz. Wenn Tacitus sich fragt, ob die Ereignisse von ewigen Gesetzen regiert werden oder ob sie dem Zufall unterliegen, antwortet er eigentlich nicht, er lässt die Frage offen, und diese Unentschiedenheit drückt gut die allgemeine Einstellung der Alten aus. Der Historiker, der mehr als jeder andere mit dieser, den historischen Prozess bildenden Mischung aus Konstanten und Verwirrungen konfrontiert wird, kommt zwangsläufig dazu, zwischen Determinismus und Kontingenz, zwischen Gesetz und Willkür, zwischen Physik und Zufall zu schwanken. Es gibt kaum ein Unheil, das wir nicht nach Belieben auf eine Zerstreutheit der Vorsehung oder auf die Gleichgültigkeit des Zufalls oder schliesslich auf die Unerbittlichkeit des Schicksals schieben können. Diese Trinität, auf die sich jedweder, vor allem aber der blasierte Geist so bequem berufen kann, ist das Tröstlichste, was die heidnische Weisheit uns zu bieten hat. Die Modernen verabscheuen es, darauf zurückzugreifen, ebenso wie sie die spezifisch antike Idee verwerfen, nach der alles Gute und alles Üble eine unveränderliche Summe darstellen, die durch nichts verwandelt werden kann. Wir mit unseren Zwangsvorstellungen vom Fortschritt und Rücklauf lassen stillschweigend gelten, dass das Übel sich ändere, sei es, dass es abnehme oder zunehme. Die Identität der Welt mit sich selber, die Vorstellung, dass sie verdammt ist so zu sein wie sie ist, die Idee das die Zukunft den jetzt gültigen Gegebenheiten nichts Wesentliches hinzufügen wird, dieser schöne Gedanke hat keinen Kurswert mehr weil die Zukunft, der Gegenstand der Hoffnung oder des Schreckens, unser wahrer Ort ist; dort leben wir, er ist alles für uns. Die fixe Idee der Erwartung, die etwas wesentlich Christliches ist und die Zeit zu einem Begriff des Immanenten und Möglichen reduziert, setzt uns ausserstande, einen unwandelbaren Moment zu begreifen, der, der Geissel der Aufeinanderfolge entzogen, in sich selber ruht. Selbst ohne den geringsten Inhalt, ist die Erwartung eine Leere, die uns erfüllt, eine Angst, die uns beruhigt, so unfähig sind wir zu einer statischen Schau: »Gott braucht sein Werk nicht zu verbessern« – diese Meinung des Celsus, die mit der Meinung einer ganzen Kultur übereinstimmt, steht im Gegensatz zu unseren Neigungen; zu unseren Instinkten, ja sogar zu unserem Wesen. Wir können sie nur in einem aussergewöhnlich lichten Moment bestätigen. Sie steht sogar im Gegensatz zu dem, was der Gläubige denkt, denn das, was man Gott in religiösen Kreisen mehr noch als in anderen vorwirft; ist sein gutes Gewissen, seine Gleichgültigkeit gegenüber der Qualität seines Werkes und seine Weigerung, dessen Anomalien zu mildern. Wir brauchen Zukunft um jeden Preis. Der Glaube an das Jüngste Gericht hat die psychologischen Bedingungen des Glaubens an den Sinn der Geschichte geschaffen; besser noch: die ganze Geschichtsphilosophie ist nur ein Nebenerzeugnis der Idee des Jüngsten Gerichts: Wir mögen noch so sehr dieser oder jener zyklischen Theorie zuneigen, es handelt. sich unsererseits doch nur um eine abstrakte Zustimmung; wir verhalten uns tatsächlich so, als oh die Geschichte sich linear entwickelte, als ob die verschiedenen Kulturen, die einander darin ablösen, nur Etappen irgendeiner grossen Absicht seien, deren Name je nach unseren Glaubensbekenntnissen oder Ideologien variiert.
Gibt es einen besseren Beweis für die Schwäche unseres Glaubens als dieTatsache, dass es für uns keine falschen Götter mehr gibt? Man kann sich kaum vorstellen, wie für einen Gläubigen der Gott, zu dem er betet, und ein ganz anderer in gleicher Weise legitim sein könnten. Der Glaube ist Ausschliessung, Herausforderung. Weil das Christentum die anderen Religionen nicht mehr verabscheuen kann, weil es die anderen Religionen versteht, ist es am Ende: die von der Intoleranz erzeugte Vitalität geht ihm immer mehr verloren. Die Intoleranz war seine Daseinsberechtigung. Zu seinem Unglück hat es aufgehört, abscheulich zu sein. Ebenso wie der zu Ende gehende Polytheismus ist es erkrankt, gelähmt durch eine zu grosse Weite des Blicks. Sein Gott geniesst bei uns ebensowenig Prestige wie Jupiter bei den ruinierten Heiden.
Todeserklärung des Christentums? Man wagt es nicht, die Religion frei heraus anzugreifen, darum nimmt man sich den Chef vor, dem man vorwirft, unaktuell, schüchtern und gemässigt zu sein . Ein Gott, der sein Kapital an Grausamkeit verschwendet hat, wird von niemandem mehr gefürchtet oder respektiert. Wir sind von all den Jahrhunderten geprägt worden, in denen an ihn glauben soviel wie ihn fürchten hiess, in denen unsere Ängste ihn sich zugleich teilnahmsvoll und skrupellos vorstellen. Wen würde er heute einschüchtern, da die Gläubigen selber fühlen, dass er überholt ist, dass man ihn nicht mehr mit der Gegenwart und noch viel weniger mit der Zukunft vereinbaren kann? Und genauso wie das Heidentum dem Christentum weichen musste, so wird sich das Christentum irgendeinem neuen Glauben beugen müssen; ohne seine Aggressivität stellt es dem Einfall anderer Götter kein Hindernis mehr entgegen; sie brauchen nur aufzutauchen, und sie werden vielleicht auftauchen. Wahrscheinlich werden sie weder das Gesicht noch die Maske der Götter tragen; aber sie werden nicht weniger furchterregend sein.
Für einen, dem Freiheit und Wahn gleich viel bedeuten, ist ein Glaube, woher er auch-kommen mag, und selbst, wenn er antireligiös wäre, ein heilsames Hindernis, eine ersehnte, erträumte Fessel, deren Funktion es ist, die Neugier und das Fieber zu hemmen, die Angst vor dem Unbegrenzten, Unbestimmten aufzuheben. Wenn dieser Glaube triumphiert und Fuss fasst, so ist das unmittelbare Ergebnis eine Verringerung der Zahl der Fragen, die man sich stellen muss, sowie eine beinahe tragische Verminderung der Optionen. Von der Qual der Wahl wird man befreit; es wird für einen gewählt. Die raffinierten Heiden, die sich von der neuen Religion verlocken liessen, erwarteten von ihr gerade, dass man für sie wählte, dass man ihnen zeigte, wohin sie gehen sollten, damit sie nicht mehr an der Schwelle so vieler Tempel zu zögern und nicht mehr zwischen so vielen Göttern zu lavieren brauchten. Aus Müdigkeit, aus Widerwillen gegen Wanderungen des Geistes entstand jener religiöse Überschwang ohne Credo, der die ganze alexandrinische Zeit charakterisiert. Man kündigt der Koexistenz der Wahrheiten auf, weil man sich mit dem Wenigen, das jede einzelne bietet, nicht mehr begnügt; man strebt zum Ganzen, aber zu einem begrenzten, sicheren Ganzen, so gross ist die Angst, vom Universellen ins Ungewisse und vom Ungewissen ins Prekäre und Amorphe zu stürzen. Die Erfahrung dieses Hinunterpurzelns, die das Heidentum zu seiner Zeit machte, macht nun das Christentum. Es stürzt herab von seiner Höhe, es beschleunigt diesen Verfall; gerade das macht es den Ungläubigen erträglich, die sich dem Christentum gegenüber immer wohlwollender verhalten. Selbst das besiegte Heidentum wurde noch gehasst; die Christen waren Wütende, die nicht vergessen konnten, während heutzutage alle Welt dem Christentum verziehen hat. Schon im 18. Jahrhundert hatte man die Argumente gegen das Christentum erschöpft. Wie ein Gift, das seine Kraft verloren hat, kann es niemanden mehr retten und niemanden mehr verdammen. Es hat jedoch zu viele Götter gestürzt, als dass es gerechterweise dem Schicksal, das es ihnen bereitet hat, entrinnen könnte. Die Stunde der Rache ist gekommen. Ihre Freude heim Anblick ihres schlimmsten Feindes muss gross sein, da dieser ebenso tief gesunken ist wie sie, weil er auf alle ohne Ausnahme eingeht. Zur Zeit seines Triumphs hat er überall, wo er gerade erschien, die Tempel zerstört und die Gewissen vergewaltigt. Ein neuer Gott, und wenn er auch tausendmal gekreuzigt worden sein mag, kennt kein Mitleid, zermalmt alles auf seinem Weg und strebt nur danach, soviel Raum wie möglich zu gewinnen. So lässt er uns teuer bezahlen, dass wir ihn nicht früher erkannt haben. Solange er noch in Dunkel gehüllt war, machte er einen gewissen Reiz haben: wir erkannten bei ihm noch nicht die Stigmata des Sieges.
Eine Religion ist nie »edler«, als wenn sie soweit kommt, dass sie sich selber für einen Aberglauben hält und gleichgültig ihrem eigenen Verschwinden beiwohnt. Die Entstehung und Ausbreitung des Christentums hat sich im Hass gegen alles, was nicht so war, wie es selber, vollzogen; dieser Hass hat es während seiner ganzen Laufbahn getragen; da seine Laufbahn zu Ende ist, ist es auch mit seinem Hass zu Ende. Christus wird nicht wieder in die Hölle hinabsteigen, man hat ihn wieder ins Grab gelegt, und diesmal wird er darin bleiben, er wird wahrscheinlich nie mehr daraus hervorkommen: er hat auf der Oberfläche der Erde und in der Tiefe der Erde niemanden mehr zu erlösen. Wenn man an die Exzesse denkt, die die Anfänge seiner Herrschaft begleiteten, kann man nicht umhin, den Ausruf des Rutilius Namatianus, des letzten heidnischen Dichters zu erwähnen: »Hätte es den Göttern doch gefallen, dass Judäa nie erobert worden wäre!«
Da man zugibt, dass die Götter ohne jeden Unterschied wahr sind, Warum auf halbem Wege haltmachen, warum nicht alle loben? Das wäre von seiten der Kirche eine höchste Vollendung: sie würde, sich vor ihren Opfern verbeugend, zugrunde gehen … Es gibt Zeichen, die dafür sprechen, dass sie versucht ist, dies zu tun. So würde sie es sich, wie die antiken Tempel, zur Ehre gereichen lassen, die Gottheiten, die Wracks von überall her aufzunehmen. Aber wieder einmal müsste der wahre Gott weichen, damit alle anderen wieder auftauchen könnten.
1378-1392
Bron: Cioran, E.M., Werke, Frankfurt am Main 2008 (Suhrkamp) – Uit: Die Verfehlte Schöpfung (vertaling: François Bondy)